B"H
"Was, so habe ich mir das nicht vorgestellt."
"Was, das habe ich ja noch gar nicht gewußt."
Diese Sätze bekomme ich fast täglich von allerlei Leuten zu hören, sobald ich von der haredischen bzw. chassidischen Gesellschaft berichte. Insbesondere natürlich an der Uni, wo die Professoren gewöhnlich ihre Vorlesungen vorbereiten, indem sie Bücher lesen und sich durch jegliche Literatur quälen. Das Witzige ist jedesmal, dass niemand von ihnen auch nur auf die Idee kommt, sich einmal in der haredischen Gesellschaft zu nähern und besonders mit den Chassidim eine Weile zu verbringen. Wenn ich hier wiederholt von Chassidim rede, dann meine ich damit NICHT Chabad oder Breslov, sondern den Hardcore, wie man vielleicht in der Umgangssprache sagen würde. Hardcore bedeutet in dem Fall Vishnitz, Toldot Aharon, Avraham Yitzchak, Gur, Belz, Dushinsky, Satmar und viele viele weitere.
Einmal traf ich einen deutschen Professor, der ein Buch über die Chassidim von Karlin schrieb. Als ich ihn fragte, ob er denn selbst einmal bei Karlin in Mea Shearim vorgesprochen habe, schaute er mich entgeistert. Nein, er habe doch hier seine Bücher und das reiche ja aus.
Wenn ich solche Ansichten höre, drehe ich jedesmal fast durch. Was würde geschehen, wenn besagter Prof in Deutschland seine Referate über Karlin hält und ein richtiger Chassid anwesend ist. Der Prof würde in Grund und Boden geredet werden. Aber wie sagte jemand zu mir: Solche Leute, die meinen, sie kennen alles und waren nie dort, referieren eh nur vor einem Publikum, welches eh nicht weiß, ob der Referent die Wahrheit sagt oder nicht. Was wissen deutsche Zuhörer von Satmar ? Da kommt halt jemand vorbei und referiert bzw. schreibt einen Artikel und den Stoff dazu hat er sich aus dem Internet oder anderer Literatur gezogen. Okay, die Leute glauben was er sagt. Säße dagegen jemand von Satmar dabei, dann käme es zum Krach, was denn der Referent da für einen stereotypen Müll von sich gebe.
Warum schreibe ich das alles alle paar Monate wieder ?
Weil ich gestern zufällig auf einen Artikel über Haredim (Ultra - Orthod.) im Internet stieß. Verfasst von einer Deutschen, die absolut keinerlei Ahnung bzw. Zugang zum Thema hat. Okay, das kommt ständig vor. Was soll man sich da noch groß aufregen ?
Das Problem aber beginnt damit, dass sie mich bzw. von meiner Site Hamantaschen zitierte. Falsch, wohlgemerkt.
Eine e - mail Adresse war leider nicht aufzufinden, sonst hätte ich der Dame etwas getippt.
Laut dem Artikel fuhr die Dame mit dem Bus in die überwiegend haredische Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv und dachte so bei sich: "Oh, das sind also die Haredim hier auf der Straße und die sind alle gegen den Staat Israel".
Zitiert hatte sie zusätzlich einiges aus einem meiner früheren Artikel.
Ich weiß nicht, wie oft ich es schon erklärte und vielleicht muß ich mich halt daran gewöhnen, es immer wieder aufs Neue zu tun:
Nicht alle Haredim sind gleich.
Es gibt Hunderte verschiedener Gruppen und Ansichten.
Nicht alle sind anti - zionistisch, nicht alle liegen faul herum und arbeiten nicht und nicht alle sind dämlich und von der Welt abgeschottet.
Dass die Fragen immer wieder neu aufkommen, ist völlig okay. Aber wenn ich als Unwissender etwas wissen will, dann frage ich professioneller und wende mich nicht an jemanden anderen, der auch keine Ahnung hat, aber vorgibt eine zu haben. So, wie ich das zum Beispiel in einigen Foren oder anderen Blogs erlebe.
Wer über die ultra - orthod. Gesellschaft als Ganzes berichten will, der muß sich die Mühe machen, jahrelang intensiv mit ihr zu tun zu haben. Mit Leuten reden, in die Synagogen gehen, über das Judentum lernen, die Hintergründe, die Gebetbücher, das Erziehungewesen….Das geht nicht von heute auf morgen und eben mal so kurz für ein Doktorat. Neulich las ich im Internet ein Doktorat eines Deutschen über die Chassidim. Ich weiß nicht, ob er seinen Doktortitel wirklich bekam, aber seine Arbeit war eine einzige Katastrophe. Alle stereotype der Literatur waren in seinem Werk vorhanden und nichts stimmte mit der realen chassidischen Gesellschaft überein.
Derzeit lese ich zwei Bücher parallel. Da ist zum einen ein Buch eines relig. Autoren über die Chassidut Satmar. Der Autor beschäftigte sich bisher mehr als 30 Jahre mit den Satmarer Chassidim und bekam irgendwann die Erlaubnis des ehemaligen großen Satmarer Rebben, Rabbi Yoel Teitelbaum, der Gesellschaft beizuwohnen und in ihr zu leben, um darüber zu berichten. Der Autor bringt das Leben der Satmarer auf wunderbare Weise dem Leser näher, eben weil er sich in der Gesellschaft befindet und dies seit Jahren.
Das zweite Buch, mit dem ich mich beschäftige ist eigentlich ein Manuskript einer Doktorarbeit. Eine junge israel. Soziologiestudentin der Bar Ilan University schrieb ihr Doktorat über die Frauen der extremen chassidischen Gruppe Toldot Aharon. Man merkt leicht den Unterschied zwischen den beiden Bücher. Der relig. Satmar - Autor bringt dem Leser mehr herüber als das akademische Faktenbuch der Doktorantin. Die Studentin hat zwar gute Arbeit geleistet, aber nicht mehr und nicht weniger. Doktortitel bekommen, aus und weg. Plan erfüllt.
Leider gab sie keine Adresse in ihrem Manuskript an, aber ich werde versuchen, sie persönlich zu erreichen und mit ihr sprechen. Allein schon deshalb, weil sie in nicht wenigen Fällen etwas anders darstellte als ich es real erlebte. Kann sein, dass bei ihr die Umstände anders lagen, aber gerne täte ich mich mit ihr unterhalten.
Dennoch besteht zwischen ihr und mir ein Unterschied. Für sie war es eine Doktorarbeit und mehr nicht. Für mich ist die chassidische Welt mehr als das und ich komme nicht eben mal vorbei, dann veröffentliche ich etwas und danach bin ich auch schon wieder weg. Die Artikel, die ich schreibe sind aufklärerischer Natur und ich identifiziere mich mit der Gesellschaft. Nicht, dass ich mich einer der Gruppen anschliesse, aber die Gesellschaft und der Chassidismus sind dennoch ein Teil von mir.
Die zwei erwähnten Autoren von Satmar und Toldot Aharon einmal ausgenommen; allgemein gilt, dass wenn ich mein Wissen über die Chassidim nur aus Literatur oder dem Internet ziehe, ich mich nicht Experte nennen kann. Wer keine persönliche jahrelange Ahnung hat, der soll es lieber lassen über die Gesellschaft zu schreiben oder zu referieren. Denn genau durch diese falschen Stereotypen entstehen noch mehr Mißverständnisse und noch mehr Vorurteile, durch welche die Gesellschaft an sich geschädigt wird.
Anerkannte Autoren zur chassidischen Welt:
Yitzchak Alfassi, David Assaf, Rivka Schatz - Uffenheimer oder Rachel Elior.
Mittwoch, Januar 16, 2008
Dienstag, Januar 15, 2008
Ist Naomi Ragen eine Haredit (Ultra - Orthod.) ?
B"H
Die bekannte amerik. - israel. Schriftstellerin Naomi Ragen macht sich in der haredischen (ultra - orthod.) Welt unbeliebt und die Forenkommentare fallen dementsprechend aus.
Naomi Ragen wurde international bekannt durch ihre Bücher, in denen sie das chassidische Leben beschreibt. Insbesondere die manchmal negative Rolle der Frau. Seit geraumer Zeit jedoch scheinen Naomi Ragen die chassidischen Themen auszugehen und sie berichtet weitgehend über andere Themen. Die Beschreibung der Rolle der Frau aber spielt auch weiterhin eine große Rolle in ihren Werken. So setzt sie sich nebenbei für benachteiligte relig. Frauen ein und rief mit einem Theaterstück großen Widerstand des ultra - orthod. Stadtteiles Mea Shearim hervor.
In einem Theaterstück verarbeitete sie eine wahre Lebensgeschichte einer Frau aus Mea Shearim. Diese hatte die Scheidung von ihrem Mann eingereicht und wurde von jenem samt chassidischen Rabbiner aus dem Stadtteil befördert. Des Weiteren ist es der Frau seit vielen Jahren untersagt, die bei dem Ehemann verbliebenen Kinder zu besuchen.
Das Theaterstück basiert auf dieser realen Geschichte, ist jedoch von etwas anderem Inhalt.
Auch das israel. TV sprang auf die Story an und lud die Schriftstellerin, die betroffene Frau sowie eine Nachbarin aus Mea Shearim ins Studio ein. Fast überflüssig zu sagen, dass das TV - Interview in einer Farce endete. Naomi Ragen und die betroffene Frau auf der einen und die Nachbarin auf der anderen Seite. Die Betroffene war nur verdeckt zu sehen, denn sie wollte ihre Anonymität wahren. Die Nachbarin vertrat die Seite des geschiedenen Ehemannes der Betroffenen und beschimpfte diese ausgiebig, ihre Kinder vernachlässigt zu haben.
Naomi Ragen

Obwohl Naomi Ragen nicht selten die haredische Welt kritisiert, sieht sie sich doch als Teil von ihr. Sie sei eine von ihnen, nur halt moderner. Allerdings kommt nun ihre ganze Identität ins Wanken, denn sie beging einen unverzeihlichen Fehler.
Zusammen mit Frauen aus einem Reform - Movement wendete sie sich an den Obersten Gerichtshof, um zu verhindern, dass immer mehr öffentliche Busse (in Jerusalem und Beit Shemesh) zu "koscheren Bussen" umfunktioniert werden. Den Forderungen haredischer Rabbiner dürfe nicht nachgegeben werden und im Bus könne jeder sitzen, wo er will. Es darf keine Sitztrennung nach Geschlechtern stattfinden:
Männer vorn und Frauen hinten.
Dies sei eine totale Diskriminierung der Frau. Außerdem kann man wohl kaum von der sekulären Bevölkerung erwarten, dass sie auf alle Forderungen der Haredim widerstandslos eingehe.
Die Haredim haben nun einen guten Grund gefunden, zurückzuschlagen. Wenn sich eine selbsternannte Haredit mit einem Bündnis der Reformbewegung zusammentue und gemeinsam mit ihnen offiziell gegen die Haredim protestiere, dann sei ja Naomi Ragens Identität mehr als fragwürdig. Sollte sie eine wahre Haredit sein, dann hätte sie keinerlei Probleme, die Entscheidung der Rabbiner anzuerkennen. Schon allein aus dem Verstehen heraus.
Dabei wird anscheinend von Naomi Ragen selbst übersehen, dass sie und die Reformer aus unterschiedlichen Zielen heraus gegen die Haredim protestieren. Den Reformern sind die Haredim eh ein Dorn im Auge, egal, was die Haredim auch tun. Selbst wenn sie nichts tun, paßt es den Reformern nicht.
Naomi Ragen dagegen kämpft unbeflissen für die Rechte der relig. Frau. Dagegen ist nichts einzuwenden und es ist notwendig, Mißstände zur Sprache zu bringen. Dennoch sollte sich Naomi Ragen nicht vor den Reform - Karren spannen lassen, denn das ruiniert ihren Ruf.
Die Schriftstellerin wohnt in einem nationalreligiösen Teil des Jerusalemer Stadtteiles Ramot. Eigentlich zu weit entfernt, um am Schabbat in die relig. haredischen Stadtteile zu laufen. Dennoch empfehle ich ihr dringend, mehr an der haredischen Gesellschaft teilzuhaben, denn sie schottet sich immer nur ab und kennt die Realität nicht mehr. Wer Fakten aus dieser Welt von sich geben will, der muß unaufhörlich mit ihr in Kontakt bleiben.
Die bekannte amerik. - israel. Schriftstellerin Naomi Ragen macht sich in der haredischen (ultra - orthod.) Welt unbeliebt und die Forenkommentare fallen dementsprechend aus.
Naomi Ragen wurde international bekannt durch ihre Bücher, in denen sie das chassidische Leben beschreibt. Insbesondere die manchmal negative Rolle der Frau. Seit geraumer Zeit jedoch scheinen Naomi Ragen die chassidischen Themen auszugehen und sie berichtet weitgehend über andere Themen. Die Beschreibung der Rolle der Frau aber spielt auch weiterhin eine große Rolle in ihren Werken. So setzt sie sich nebenbei für benachteiligte relig. Frauen ein und rief mit einem Theaterstück großen Widerstand des ultra - orthod. Stadtteiles Mea Shearim hervor.
In einem Theaterstück verarbeitete sie eine wahre Lebensgeschichte einer Frau aus Mea Shearim. Diese hatte die Scheidung von ihrem Mann eingereicht und wurde von jenem samt chassidischen Rabbiner aus dem Stadtteil befördert. Des Weiteren ist es der Frau seit vielen Jahren untersagt, die bei dem Ehemann verbliebenen Kinder zu besuchen.
Das Theaterstück basiert auf dieser realen Geschichte, ist jedoch von etwas anderem Inhalt.
Auch das israel. TV sprang auf die Story an und lud die Schriftstellerin, die betroffene Frau sowie eine Nachbarin aus Mea Shearim ins Studio ein. Fast überflüssig zu sagen, dass das TV - Interview in einer Farce endete. Naomi Ragen und die betroffene Frau auf der einen und die Nachbarin auf der anderen Seite. Die Betroffene war nur verdeckt zu sehen, denn sie wollte ihre Anonymität wahren. Die Nachbarin vertrat die Seite des geschiedenen Ehemannes der Betroffenen und beschimpfte diese ausgiebig, ihre Kinder vernachlässigt zu haben.
Naomi Ragen

Obwohl Naomi Ragen nicht selten die haredische Welt kritisiert, sieht sie sich doch als Teil von ihr. Sie sei eine von ihnen, nur halt moderner. Allerdings kommt nun ihre ganze Identität ins Wanken, denn sie beging einen unverzeihlichen Fehler.
Zusammen mit Frauen aus einem Reform - Movement wendete sie sich an den Obersten Gerichtshof, um zu verhindern, dass immer mehr öffentliche Busse (in Jerusalem und Beit Shemesh) zu "koscheren Bussen" umfunktioniert werden. Den Forderungen haredischer Rabbiner dürfe nicht nachgegeben werden und im Bus könne jeder sitzen, wo er will. Es darf keine Sitztrennung nach Geschlechtern stattfinden:
Männer vorn und Frauen hinten.
Dies sei eine totale Diskriminierung der Frau. Außerdem kann man wohl kaum von der sekulären Bevölkerung erwarten, dass sie auf alle Forderungen der Haredim widerstandslos eingehe.
Die Haredim haben nun einen guten Grund gefunden, zurückzuschlagen. Wenn sich eine selbsternannte Haredit mit einem Bündnis der Reformbewegung zusammentue und gemeinsam mit ihnen offiziell gegen die Haredim protestiere, dann sei ja Naomi Ragens Identität mehr als fragwürdig. Sollte sie eine wahre Haredit sein, dann hätte sie keinerlei Probleme, die Entscheidung der Rabbiner anzuerkennen. Schon allein aus dem Verstehen heraus.
Dabei wird anscheinend von Naomi Ragen selbst übersehen, dass sie und die Reformer aus unterschiedlichen Zielen heraus gegen die Haredim protestieren. Den Reformern sind die Haredim eh ein Dorn im Auge, egal, was die Haredim auch tun. Selbst wenn sie nichts tun, paßt es den Reformern nicht.
Naomi Ragen dagegen kämpft unbeflissen für die Rechte der relig. Frau. Dagegen ist nichts einzuwenden und es ist notwendig, Mißstände zur Sprache zu bringen. Dennoch sollte sich Naomi Ragen nicht vor den Reform - Karren spannen lassen, denn das ruiniert ihren Ruf.
Die Schriftstellerin wohnt in einem nationalreligiösen Teil des Jerusalemer Stadtteiles Ramot. Eigentlich zu weit entfernt, um am Schabbat in die relig. haredischen Stadtteile zu laufen. Dennoch empfehle ich ihr dringend, mehr an der haredischen Gesellschaft teilzuhaben, denn sie schottet sich immer nur ab und kennt die Realität nicht mehr. Wer Fakten aus dieser Welt von sich geben will, der muß unaufhörlich mit ihr in Kontakt bleiben.
Labels:
Frauen in der Orthodoxie,
Kunst
Sonntag, Januar 13, 2008
Der Klausenberger Rebbe
B"H
Trotz der unbeschreiblichen Leiden der chassidischen Gemeinden im Holocaust bleibt ein Schicksal unvergessen. Wo man in der jüdisch - orthodoxen Welt auch hinhört; wer vom Holocaust redet, der kommt automatisch auf den Klausenberger Rebben zu sprechen. Der Klausenberger Rebbe dient bis heute allen als Beispiel, wie man im Holocaust seine gesamte Familie verlieren konnte, ohne auch nur eine Minute den Glauben an G - tt zu verlieren.
Zum Holocaust - Gedenktag am 27. Januar habe ich einige Infos über den Klausenberger Rebben gesammelt. Darunter befinden sich Infos aus verschiedenen Websites sowie aus dem Buch "The Years of War - The Klausenberger Rebbe" (ins Englische übersetzt von Judah Lifshitz). Judah Lifshitz entnahm die Inhalte dem Buch "Lapid HaEish" von Aharon Surasky.
Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam wurde am 4 Schevat 5665 (10. Januar 1905) in Rudnik (Polen) geboren. Seine Eltern waren Rabbi Zvi Hirsch Halberstam und Chaya Mindel Teitelbaum. Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam sollte später der Gründer der großen chassidischen Dynastie Zanz - Klausenberg werden.
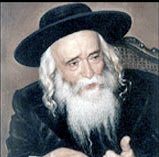
Schon als Kind war Rabbi Yekutiel eine herausragende Persönlichkeit. Schnell lernte er Thora, Halachot und Talmud und verbrachte 60 Jahre seines Lebens mit dem Unterrichten dieser Themen. Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam entstammte einer chassidischen Familien, welche ihre Wurzeln in Ungarn, Galizien, Polen und Rumänien hatte. Während seiner frühen Kindheit in Rudnik diente sein Vater dort als Gemeinderabbiner.
Im Ersten Weltkrieg war die Familie gezwungen, Rudnik zu verlassen und man liess sich in Kleinwardein nieder. Im Alter von 13 Jahren, verlor Rabbi Yekutiel seinen Vater und begann sein Studium bei berühmen Rabbinern wie u.a. Rabbi Chaim Eliezer Shapiro von Munkatch. Im Alter von 20 Jahren (1925) heiratete er Pessel Teitelbaum, die Tochter von Rabbi Chaim Zvi von Sighet (Rumänien). Im Jahre 1927 wurde er zum Rabbiner der Ortschaft Klausenberg (Transsylvanien in Rumänien) ernannt.
Die Gemeinde Klausenberg wurde zum ersten Mal im Jahre 1591 erwähnt und als Rabbi Yekutiel Yehudah sein Amt als Rabbiner begann, verfügte die Gemeinde über 16.000 Juden. Die Mehrheit der Juden war allerdings absolut sekulär, was sich nach dem Eintreffen des jungen charismatischen Rabbis schnell ändern sollte. Obwohl die Juden nicht unbedingt etwas mit der Religion zu haben wollten, war man doch neugierig, wer denn da Neues kommt. Und so kam es, dass am ersten Schabbat des Rebben in Klausenberg plötzlich 300 Mann in der Synagoge auftauchten. Der neue Klausenberger Rebbe hinterließ einen gewaltigen Eindruck. Nicht nur, dass er Religion predigte; er lebte sie auch. Sein größtes Anliegen war, der armen Bevölkerungsschicht zu dienen. Ein Großteil seines kargen Gehaltes spendete er an die Armen und nur am Schabbat gönnte er sich Brot. Außerdem gewöhnte er sich an, nur drei Stunden des nachts zu schlafen. Eine Angewohneit, die ihm später in Auschwitz zu Gute kam.
Immer dort, wo der Klausenberger Rebbe auftauchte, wurde sofort eine Yeshiva (relig. Schule) eingerichtet. So natürlich auch in Klausenberg. Im Jahre 1937 erreichte den Klausenberger Rebben eine Bitte des ersten Rebbes der Chassidut Dushinsky aus Jerusalem. Er, Rebbe Yekutiel Yehudah Halberstam, sollte doch nach Jerusalem ziehen und Rabbi im Beit Din (rabbinisches Gericht) der Chassidut Dushinsky werden. Der Klausenberger Rebbe war zwar angetan von dem Angebot, doch zögerte er. Wenige Jahre später beantragte er ein Visum für Palästina. Zu spät, denn die Nazis hatten alle Tore geschlossen. Viele Jahre später sagte der Klausenberger Rebbe, dass er nicht mehr ausreisen konnte, weil sekuläre zionistische Aktivisten den British Council überzeugt hatten, dem Rebben kein Visum auszustellen und stattdessen Zionisten zu bevorzugen.
Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, war der Klausenberger Rebbe 35 Jahre alt und war Vater von 11 Kindern. Der Holocaust kam keineswegs überraschend für den Rebben, denn fortwährend hatte er jüdische Gemeindemitglieder dazu aufgerufen, zu G - tt zurückzukehren.
Die Juden in Polen und Lithauen standen als erstes auf der Vernichtungsliste der Deutschen. In Rumänien und Ungarn ging es zuerst etwas ruhiger zu. Doch dann ging alles Knall auf Fall; der Rebbe sollte das damalige Ungarn verlassen, denn er war polnischer Staatsbürger. Mit seiner Familie wurde er nach Budapest transportiert. Er selbst kam in ein VIP - Lager und seine Frau und Kinder mußten sich mit einem gewöhnlichen Lager begnügen. Unzählige internationale Bitten gingen bei den ungarischen Behörden ein, dass man den Rebben freilassen sollte und letztendlich gab man den Bitten aus dem Ausland nach. Der Rebbe kam frei und ging in das Camp, in dem seine Familie inhaftiert war. Zusammen kehrten sie wieder nach Klausenberg zurück. Trotz vieler Aufforderungen beschloß der Rebbe bei seinen Chassidim zu bleiben, aber im Winter 1944 marschierten die Nazis in Ungarn ein und alles sollte sich zum Schlimmsten wenden.
Als erstes war die SS immer hinter bekannten chassidischen Rebben hinterher und Rabbi Halberstam entkam nur knapp durch die Hintertür als man an seine Tür anklopfte. Danach versteckte er sich einige Zeit in einem offenen Grab auf einem Friedhof. Im Mai 1944 wurde er im Lager Banya (Nadi - Banya) inhaftiert, wo ihn jedoch der ungarische Captain beschützte. Unterdessen wurden die Juden aus Klausenberg nach Auschwitz deportiert. Des Rebben Frau und seine 11 Kinder befanden sich im 5. Transport, der Klausenberg in Richtung Auschwitz verliess. Am 2. Juni 1944 (11 Sivan 5704) wurden seine Frau und zehn seiner Kinder in Auschwitz vergast.
Wenig später wurde auch der Klausenberger Rebbe nach Auschwitz deportiert. An der Rampe traf er auf Dr. Yosef Mengele, der den Rebbe zum Arbeitsdienst einteilte.
Bis heute gibt es viele Zeugenberichte über die Taten und das Verhalten des Klausenberger Rebben in Auschwitz. Völlig in seinen Gedanken zurückgezogen, lebte er in seiner eigenen Welt. Er wollte Tefillin (Gebetsriemen) anlegen, dem jüdischen Ritus nach seine Hände waschen und koscher essen. Während der gesamten Zeit in Auschwitz gelang es ihm, nur koscher zu essen.
Ein Jahr nachdem das Warschauer Ghetto dem Erdboden gleichgemacht worden war, entschlossen sich die Nazis, die hinterbliebenen Trümmer wegzuräumen. Man brauchte dringend Sklavenarbeiter und so entsandte man den Klausenberger Rebben zusammen mit weiteren Tausenden Auschwitzer Häftlingen nach Warschau. In Warschau dann nutzten viele Häftlinge die Gelegenheit zu fliehen, was der SS nicht lange verborgen blieb. Diese entschied, dass alle Juden sich einen weissen Streifen auf der Kopfmitte scheren müssen, um so schon von Weitem erkannt zu werden. Der Klausenberger Rebbe weigerte sich erfolgreich. Er band sich einfach ein weisses Tuch um sein Gesicht und den Kopf und gab vor, Zahnschmerzen zu haben.
Die Russische Armee kam immer näher und die Nazis sattelten zum Abmarsch aus Warschau. Die Häftlinge um den Klausenberger Rebben sollten nach Dachau geschickt werden, denn dort benötigte man dringend Zwangsarbeiter. Im Juli / August 1944 verliessen 6000 Häftlinge Warschau in Richtung Dachau, von denen nur 2000 ihr Ziel wirklich erreichten. Die Reise nach Dachau erfolgte teils zu Fuß und teils mit dem Zug. Die SS gab sich brutal und wer nicht schnell mithalten konnte, wurde gnadenlos erschossen. Es war ein einziges Gemetzel.
Monate später wurde der Klausenberger Rebbe, Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam, von der amerikanischen Armee in Dachau befreit. Als einziger seiner Familie hatte er überlebt. Zwar wurde ihm kurz darauf zugetragen, dass sein ältester Sohn Lipele unter den Überlebenden war, doch ehe der Klausenberger Rebbe zu ihm gelangen konnte, verstarb der geschwächte Lipele.
Obwohl der Rebbe selbst nicht bei bester Gesundheit war, so war es sein großes Anliegen, sich um die zu Tode eingeschüchterten Holocaust - Überlebenden zu kümmern. Der Klausenberger Rebbe war ein Beispiel dafür, wie man alles verlieren kann, und dennoch zu G - tt steht. "Ich habe alles verloren, doch nicht G - tt", so sagte er einmal.
Nach dem Krieg versorgte er die Juden in den deutschen DP - Camps Muldorf und Föhrenwald. Er kümmerte sich um koscheres Essen und versuchte, den Juden etwas Spiritualität zurückzugeben.
Die finanzielle Situation der relig. Juden in den DP - Camps wurde immer katastrophaler und so entschloß sich der Rebbe, in die Staaten zu fahren, um Spendengelder zu sammeln. Dort wurde er begeistert empfangen, denn sein Ruf drang in alle Welt. Am 22 Sivan (21. Juni) 1946 betrat der Rebbe von Klausenberg amerikanischen Boden und sammelte 100.000 Dollar. Natürlich wollte man, dass er in den USA bleibe, doch Rabbi Yekutiel Yehudah kehrte nach Deutschland zurück und sorgte dafür, neue Lehranstalten für die Juden aufzubauen.
Im Jahre 1947 heiratete er seine zweite Frau Chaya Nechama Ungar, die Tochter von Rabbi Samuel David Ungar. Mit ihr hatte er fünf Töchter und zwei Söhne. Er verließ Deutschland und zog in die Staaten, wo er in Williamsburgh / New York die Gemeinde der Zanz - Klausenberg - Gruppe aufbaute. Anfang der 60iger Jahre zog er nach Israel. Hier baute er eine eigene Gemeinde neben der Stadt Netanya auf. Kiryat Zanz. Einen kleinen Ableger davon gibt es auch in Jerusalem. Kiryat Zanz in Netanya verfügt ebenso über ein hochangesehenes Krankenhaus, das Laniado - Hospital.
Rebbe Yekutiel Yehudah Halberstam startete als der jüngste chassidische Rebbe in Osteuropa und sein Ruf drang über den Holocaust hinaus in jede Ecke der Welt. Er war hochangesehen, charismatisch und kümmerte sich um alle Juden. Egal, ob relig., chassidisch oder nicht. Sein Anliegen war, dass jeder Jude mehr über seine Religion lernen muß und zahlreiche Yeshivot wurden eröffnet. Gerade nach dem Holocaust verlangten die Juden nach einem spirituellen Führer, der ihre Leiden kannte und der Klausenberger Rebbe füllte diese Aufgabe par excellence aus.
Der große Klausenberger Rebbe verstarb am 18. Juni 1994 in der israel. Küstenstadt Netanya, wo er auch begraben liegt. Seine beiden Söhne leiten je die Zanz - Klausenberg Gemeinden in Netanya sowie in Brooklyn.
Weitere Links zur Chassidut Zanz - Klausenberg:
http://www.klausenburg.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yekusiel_Yehudah_Halberstam
http://www.targum.com/excerpts/klausenberg.html
Zusätzliche Berichte plane ich über die chassidische Gruppe Bobov sowie die wundersame Rettung des Belzer Rebben vor der Gestapo.
Trotz der unbeschreiblichen Leiden der chassidischen Gemeinden im Holocaust bleibt ein Schicksal unvergessen. Wo man in der jüdisch - orthodoxen Welt auch hinhört; wer vom Holocaust redet, der kommt automatisch auf den Klausenberger Rebben zu sprechen. Der Klausenberger Rebbe dient bis heute allen als Beispiel, wie man im Holocaust seine gesamte Familie verlieren konnte, ohne auch nur eine Minute den Glauben an G - tt zu verlieren.
Zum Holocaust - Gedenktag am 27. Januar habe ich einige Infos über den Klausenberger Rebben gesammelt. Darunter befinden sich Infos aus verschiedenen Websites sowie aus dem Buch "The Years of War - The Klausenberger Rebbe" (ins Englische übersetzt von Judah Lifshitz). Judah Lifshitz entnahm die Inhalte dem Buch "Lapid HaEish" von Aharon Surasky.
Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam wurde am 4 Schevat 5665 (10. Januar 1905) in Rudnik (Polen) geboren. Seine Eltern waren Rabbi Zvi Hirsch Halberstam und Chaya Mindel Teitelbaum. Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam sollte später der Gründer der großen chassidischen Dynastie Zanz - Klausenberg werden.
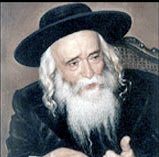
Schon als Kind war Rabbi Yekutiel eine herausragende Persönlichkeit. Schnell lernte er Thora, Halachot und Talmud und verbrachte 60 Jahre seines Lebens mit dem Unterrichten dieser Themen. Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam entstammte einer chassidischen Familien, welche ihre Wurzeln in Ungarn, Galizien, Polen und Rumänien hatte. Während seiner frühen Kindheit in Rudnik diente sein Vater dort als Gemeinderabbiner.
Im Ersten Weltkrieg war die Familie gezwungen, Rudnik zu verlassen und man liess sich in Kleinwardein nieder. Im Alter von 13 Jahren, verlor Rabbi Yekutiel seinen Vater und begann sein Studium bei berühmen Rabbinern wie u.a. Rabbi Chaim Eliezer Shapiro von Munkatch. Im Alter von 20 Jahren (1925) heiratete er Pessel Teitelbaum, die Tochter von Rabbi Chaim Zvi von Sighet (Rumänien). Im Jahre 1927 wurde er zum Rabbiner der Ortschaft Klausenberg (Transsylvanien in Rumänien) ernannt.
Die Gemeinde Klausenberg wurde zum ersten Mal im Jahre 1591 erwähnt und als Rabbi Yekutiel Yehudah sein Amt als Rabbiner begann, verfügte die Gemeinde über 16.000 Juden. Die Mehrheit der Juden war allerdings absolut sekulär, was sich nach dem Eintreffen des jungen charismatischen Rabbis schnell ändern sollte. Obwohl die Juden nicht unbedingt etwas mit der Religion zu haben wollten, war man doch neugierig, wer denn da Neues kommt. Und so kam es, dass am ersten Schabbat des Rebben in Klausenberg plötzlich 300 Mann in der Synagoge auftauchten. Der neue Klausenberger Rebbe hinterließ einen gewaltigen Eindruck. Nicht nur, dass er Religion predigte; er lebte sie auch. Sein größtes Anliegen war, der armen Bevölkerungsschicht zu dienen. Ein Großteil seines kargen Gehaltes spendete er an die Armen und nur am Schabbat gönnte er sich Brot. Außerdem gewöhnte er sich an, nur drei Stunden des nachts zu schlafen. Eine Angewohneit, die ihm später in Auschwitz zu Gute kam.
Immer dort, wo der Klausenberger Rebbe auftauchte, wurde sofort eine Yeshiva (relig. Schule) eingerichtet. So natürlich auch in Klausenberg. Im Jahre 1937 erreichte den Klausenberger Rebben eine Bitte des ersten Rebbes der Chassidut Dushinsky aus Jerusalem. Er, Rebbe Yekutiel Yehudah Halberstam, sollte doch nach Jerusalem ziehen und Rabbi im Beit Din (rabbinisches Gericht) der Chassidut Dushinsky werden. Der Klausenberger Rebbe war zwar angetan von dem Angebot, doch zögerte er. Wenige Jahre später beantragte er ein Visum für Palästina. Zu spät, denn die Nazis hatten alle Tore geschlossen. Viele Jahre später sagte der Klausenberger Rebbe, dass er nicht mehr ausreisen konnte, weil sekuläre zionistische Aktivisten den British Council überzeugt hatten, dem Rebben kein Visum auszustellen und stattdessen Zionisten zu bevorzugen.
Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, war der Klausenberger Rebbe 35 Jahre alt und war Vater von 11 Kindern. Der Holocaust kam keineswegs überraschend für den Rebben, denn fortwährend hatte er jüdische Gemeindemitglieder dazu aufgerufen, zu G - tt zurückzukehren.
Die Juden in Polen und Lithauen standen als erstes auf der Vernichtungsliste der Deutschen. In Rumänien und Ungarn ging es zuerst etwas ruhiger zu. Doch dann ging alles Knall auf Fall; der Rebbe sollte das damalige Ungarn verlassen, denn er war polnischer Staatsbürger. Mit seiner Familie wurde er nach Budapest transportiert. Er selbst kam in ein VIP - Lager und seine Frau und Kinder mußten sich mit einem gewöhnlichen Lager begnügen. Unzählige internationale Bitten gingen bei den ungarischen Behörden ein, dass man den Rebben freilassen sollte und letztendlich gab man den Bitten aus dem Ausland nach. Der Rebbe kam frei und ging in das Camp, in dem seine Familie inhaftiert war. Zusammen kehrten sie wieder nach Klausenberg zurück. Trotz vieler Aufforderungen beschloß der Rebbe bei seinen Chassidim zu bleiben, aber im Winter 1944 marschierten die Nazis in Ungarn ein und alles sollte sich zum Schlimmsten wenden.
Als erstes war die SS immer hinter bekannten chassidischen Rebben hinterher und Rabbi Halberstam entkam nur knapp durch die Hintertür als man an seine Tür anklopfte. Danach versteckte er sich einige Zeit in einem offenen Grab auf einem Friedhof. Im Mai 1944 wurde er im Lager Banya (Nadi - Banya) inhaftiert, wo ihn jedoch der ungarische Captain beschützte. Unterdessen wurden die Juden aus Klausenberg nach Auschwitz deportiert. Des Rebben Frau und seine 11 Kinder befanden sich im 5. Transport, der Klausenberg in Richtung Auschwitz verliess. Am 2. Juni 1944 (11 Sivan 5704) wurden seine Frau und zehn seiner Kinder in Auschwitz vergast.
Wenig später wurde auch der Klausenberger Rebbe nach Auschwitz deportiert. An der Rampe traf er auf Dr. Yosef Mengele, der den Rebbe zum Arbeitsdienst einteilte.
Bis heute gibt es viele Zeugenberichte über die Taten und das Verhalten des Klausenberger Rebben in Auschwitz. Völlig in seinen Gedanken zurückgezogen, lebte er in seiner eigenen Welt. Er wollte Tefillin (Gebetsriemen) anlegen, dem jüdischen Ritus nach seine Hände waschen und koscher essen. Während der gesamten Zeit in Auschwitz gelang es ihm, nur koscher zu essen.
Ein Jahr nachdem das Warschauer Ghetto dem Erdboden gleichgemacht worden war, entschlossen sich die Nazis, die hinterbliebenen Trümmer wegzuräumen. Man brauchte dringend Sklavenarbeiter und so entsandte man den Klausenberger Rebben zusammen mit weiteren Tausenden Auschwitzer Häftlingen nach Warschau. In Warschau dann nutzten viele Häftlinge die Gelegenheit zu fliehen, was der SS nicht lange verborgen blieb. Diese entschied, dass alle Juden sich einen weissen Streifen auf der Kopfmitte scheren müssen, um so schon von Weitem erkannt zu werden. Der Klausenberger Rebbe weigerte sich erfolgreich. Er band sich einfach ein weisses Tuch um sein Gesicht und den Kopf und gab vor, Zahnschmerzen zu haben.
Die Russische Armee kam immer näher und die Nazis sattelten zum Abmarsch aus Warschau. Die Häftlinge um den Klausenberger Rebben sollten nach Dachau geschickt werden, denn dort benötigte man dringend Zwangsarbeiter. Im Juli / August 1944 verliessen 6000 Häftlinge Warschau in Richtung Dachau, von denen nur 2000 ihr Ziel wirklich erreichten. Die Reise nach Dachau erfolgte teils zu Fuß und teils mit dem Zug. Die SS gab sich brutal und wer nicht schnell mithalten konnte, wurde gnadenlos erschossen. Es war ein einziges Gemetzel.
Monate später wurde der Klausenberger Rebbe, Rabbi Yekutiel Yehudah Halberstam, von der amerikanischen Armee in Dachau befreit. Als einziger seiner Familie hatte er überlebt. Zwar wurde ihm kurz darauf zugetragen, dass sein ältester Sohn Lipele unter den Überlebenden war, doch ehe der Klausenberger Rebbe zu ihm gelangen konnte, verstarb der geschwächte Lipele.
Obwohl der Rebbe selbst nicht bei bester Gesundheit war, so war es sein großes Anliegen, sich um die zu Tode eingeschüchterten Holocaust - Überlebenden zu kümmern. Der Klausenberger Rebbe war ein Beispiel dafür, wie man alles verlieren kann, und dennoch zu G - tt steht. "Ich habe alles verloren, doch nicht G - tt", so sagte er einmal.
Nach dem Krieg versorgte er die Juden in den deutschen DP - Camps Muldorf und Föhrenwald. Er kümmerte sich um koscheres Essen und versuchte, den Juden etwas Spiritualität zurückzugeben.
Die finanzielle Situation der relig. Juden in den DP - Camps wurde immer katastrophaler und so entschloß sich der Rebbe, in die Staaten zu fahren, um Spendengelder zu sammeln. Dort wurde er begeistert empfangen, denn sein Ruf drang in alle Welt. Am 22 Sivan (21. Juni) 1946 betrat der Rebbe von Klausenberg amerikanischen Boden und sammelte 100.000 Dollar. Natürlich wollte man, dass er in den USA bleibe, doch Rabbi Yekutiel Yehudah kehrte nach Deutschland zurück und sorgte dafür, neue Lehranstalten für die Juden aufzubauen.
Im Jahre 1947 heiratete er seine zweite Frau Chaya Nechama Ungar, die Tochter von Rabbi Samuel David Ungar. Mit ihr hatte er fünf Töchter und zwei Söhne. Er verließ Deutschland und zog in die Staaten, wo er in Williamsburgh / New York die Gemeinde der Zanz - Klausenberg - Gruppe aufbaute. Anfang der 60iger Jahre zog er nach Israel. Hier baute er eine eigene Gemeinde neben der Stadt Netanya auf. Kiryat Zanz. Einen kleinen Ableger davon gibt es auch in Jerusalem. Kiryat Zanz in Netanya verfügt ebenso über ein hochangesehenes Krankenhaus, das Laniado - Hospital.
Rebbe Yekutiel Yehudah Halberstam startete als der jüngste chassidische Rebbe in Osteuropa und sein Ruf drang über den Holocaust hinaus in jede Ecke der Welt. Er war hochangesehen, charismatisch und kümmerte sich um alle Juden. Egal, ob relig., chassidisch oder nicht. Sein Anliegen war, dass jeder Jude mehr über seine Religion lernen muß und zahlreiche Yeshivot wurden eröffnet. Gerade nach dem Holocaust verlangten die Juden nach einem spirituellen Führer, der ihre Leiden kannte und der Klausenberger Rebbe füllte diese Aufgabe par excellence aus.
Der große Klausenberger Rebbe verstarb am 18. Juni 1994 in der israel. Küstenstadt Netanya, wo er auch begraben liegt. Seine beiden Söhne leiten je die Zanz - Klausenberg Gemeinden in Netanya sowie in Brooklyn.
Weitere Links zur Chassidut Zanz - Klausenberg:
http://www.klausenburg.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yekusiel_Yehudah_Halberstam
http://www.targum.com/excerpts/klausenberg.html
Zusätzliche Berichte plane ich über die chassidische Gruppe Bobov sowie die wundersame Rettung des Belzer Rebben vor der Gestapo.
Labels:
Chassidut,
Chassidut Zanz - Klausenburg,
Holocaust,
Rabbis
Samstag, Januar 12, 2008
Kalt aber nicht langweilig
B"H
Jerusalem zittert vor Kälte. Minusgrade und jeder, der kann, sucht sich ein warmes Plätzchen. Sogar Handschuhe sind keine Seltenheit mehr.
Als ich mich abends auf den Weg nach Maalot Dafna, zum Haus von Rabbi Mordechai Machlis, machte, traf ich kurz darauf schon auf den ersten Chassid. Ein Vishnitzer Chassid, den ich von der Uni her kenne, und der relig. Bücher schreibt. In Mea Shearim trennten sich unsere Wege, dennoch hatten wir vorher viel Zeit zum Reden. Er zählte mir sämtliche Vishnitzer Rebben auf. Natürlich kamen auch die internen Probleme der chassidischen Gruppe Vishnitz zur Sprache. Zwei Söhne des derzeitigen kranken Rebben in Bnei Brak streiten sich um dessen Nachfolge und Vishnitz spaltet sich daher immer mehr in zwei Lager auf.
Nach den Machlises wagten wir es erneut und waren erfolgreich. Immer, wenn meine Freundin und ich zum chassidischen Tisch des Rebben der Chassidut Dushinksy gehen, kommt etwas dazwischen. Entweder haben Frauen keinen Einlass oder es findet kein Tisch statt. Gestern dann war alles anders und wir fanden einen hervorragenden Platz mit toller Aussicht auf die Chassidim und den Rebben, Rabbi Yosef Zvi Dushinsky.
Der derzeitige Dushinsky Rebbe: Rabbi Zvi Dushinsky mit Gebetbuch

Der Tisch bei Dushinsky ist mit zwei Stunden relativ kurz, doch muss ich sagen, dass dort die Lieder am besten anzuhören sind. Obwohl die Chassidut Belz die besten chassidischen Melodien hat, wird bei Dushinsky geradezu chormässig gesungen. Sogar im Kanon. Ein führender Rabbiner sowie der Rebbe selbst gaben recht lange ausführliche Derashot (relig. Reden) zum Schabbat. Meistens allerdings wird dort gesungen.
Zum Schluss tanzt der Rebbe zusammen mit einigen Chassidim dreimal im Kreis um den grossen Tisch herum und danach stellt er sich auf, um jeden einzelnen Chassid mit "Gid Schabbes" zu verabschieden. Rebbe Yosef Zvi Dushinsky ist ein eher ernster Charakter, doch weiss er, was er sagt. Die Chassidut Dushinsky ist außerhalb chassidischer Zirkel weniger bekannt. Erstens ist es eine kleine Gruppe und wurde erst vor ca. 70 jahren gegründet. Und zweitens bewegt sich Dushinsky fast nur innerhalb der anti - zionistischen Dachgruppe Mea Shearims, in der Edah HaCharedit. Obwohl Dushinsky relativ klein ist, hat die Gruppe einen enormen Einfluss in der Edah. Der Gründer der Gruppe, auch ein Rebbe namens Yosef Zvi Dushinsky (der Maharitz) fuhr im Jahre 1948 nach New York und versuchte die UNO zu überzeugen, keinen Staat Israel zuzulassen. Bis heute ist Dushinsky absolut anti - zionistisch.
Mehr zum Antizionismus hier:
http://hamantaschen.blogspot.com/2007/11/der-talmudisch-begrndete-antizionismus.html
Nach Dushinsky zogen wir durch die Yoel Street nach Mea Shearim. Obwohl es schon spät war, beschlossen wir, wenigstens noch bei der Chassidut Kretchnif Jerusalem vorbei zuschauen. Bei Kretchnif ist mehr Stimmung als bei Dushinsky und viele Chassidim, die wir vorher bei Dushinsky gesichtet hatten, standen nun am Tisch des Kretchnifer Rebben. Einschließlich des Sohnes des Kretchnifer Rebben.
Neben dem Rebben der Toldot Aharon Yitzchak ist der Kretchnifer Rebbe der beste Entertainer. Sein Tisch ist euphorisch und wer nicht mitmacht, wird vom Rebben persönlich angefeuert. Leider verpassten wir gestern den alleinigen Tanze des Rebben, doch waren wir gegenwärtig als er zusammen mit seinen Chassidim im Kreis tanzte. Dies ist die beste Show, denn vorher tanzen alle eintönig und sobald der Rebbe mit einstimmt, geht die Post ab. Dann kommt Stimmung und Bewegung in den Kreis.
Viele Frauen waren nicht oben auf der Empore. Nur die Rebbitzen und einige weibl. Familienangehörigen. Die Rebbitzen kam gegen Ende auf mich zu und wir unterhielten uns. Eines ist sicher; wenn ich Details ueber Kretchnif brauche und einen Ansprechpartner suche, steht sie zur Verfügung. Das hatten wir bisher noch nicht, dass sich eine Rebbitzen persönlich bereit erklärte. Sie ist eine etwas ältere Dame mit einem sehr guten Sinn für Humor.
Nach Kretchnif fuehrte unser Weg durch den Markt von Mea Shearim. Mittlerweile war es 2.00 Uhr frueh und viele Leute waren nicht mehr unterwegs. Leider fanden wir die Synagoge der Neturei Karta nicht und sind gezwungen eingehend zu fragen. Dafür fanden wir einige andere interessante Synagogen im Markt. Dann kam auch noch ein Krankenwagen mit Blaulicht langsam um die Ecke gebogen und sofort rannten zwei Chassidim der Avraham Yitzchak aus der Synagoge auf die Strasse hinaus. Normalerweise werden Autos am Schabbat gesteinigt, doch bei Ambulanzen geschieht nichts und die Chassidim zogen sich zurueck.
Der Markt von Mea Shearim ist eine Hochburg der Neturei Karta und die Grafittis zu lesen, ist immer recht lustig. "Zionisten Raus" und "Free Palestine" war zu lesen.
Alles in allem eine gelungene Tischnacht.
Jerusalem zittert vor Kälte. Minusgrade und jeder, der kann, sucht sich ein warmes Plätzchen. Sogar Handschuhe sind keine Seltenheit mehr.
Als ich mich abends auf den Weg nach Maalot Dafna, zum Haus von Rabbi Mordechai Machlis, machte, traf ich kurz darauf schon auf den ersten Chassid. Ein Vishnitzer Chassid, den ich von der Uni her kenne, und der relig. Bücher schreibt. In Mea Shearim trennten sich unsere Wege, dennoch hatten wir vorher viel Zeit zum Reden. Er zählte mir sämtliche Vishnitzer Rebben auf. Natürlich kamen auch die internen Probleme der chassidischen Gruppe Vishnitz zur Sprache. Zwei Söhne des derzeitigen kranken Rebben in Bnei Brak streiten sich um dessen Nachfolge und Vishnitz spaltet sich daher immer mehr in zwei Lager auf.
Nach den Machlises wagten wir es erneut und waren erfolgreich. Immer, wenn meine Freundin und ich zum chassidischen Tisch des Rebben der Chassidut Dushinksy gehen, kommt etwas dazwischen. Entweder haben Frauen keinen Einlass oder es findet kein Tisch statt. Gestern dann war alles anders und wir fanden einen hervorragenden Platz mit toller Aussicht auf die Chassidim und den Rebben, Rabbi Yosef Zvi Dushinsky.
Der derzeitige Dushinsky Rebbe: Rabbi Zvi Dushinsky mit Gebetbuch

Der Tisch bei Dushinsky ist mit zwei Stunden relativ kurz, doch muss ich sagen, dass dort die Lieder am besten anzuhören sind. Obwohl die Chassidut Belz die besten chassidischen Melodien hat, wird bei Dushinsky geradezu chormässig gesungen. Sogar im Kanon. Ein führender Rabbiner sowie der Rebbe selbst gaben recht lange ausführliche Derashot (relig. Reden) zum Schabbat. Meistens allerdings wird dort gesungen.
Zum Schluss tanzt der Rebbe zusammen mit einigen Chassidim dreimal im Kreis um den grossen Tisch herum und danach stellt er sich auf, um jeden einzelnen Chassid mit "Gid Schabbes" zu verabschieden. Rebbe Yosef Zvi Dushinsky ist ein eher ernster Charakter, doch weiss er, was er sagt. Die Chassidut Dushinsky ist außerhalb chassidischer Zirkel weniger bekannt. Erstens ist es eine kleine Gruppe und wurde erst vor ca. 70 jahren gegründet. Und zweitens bewegt sich Dushinsky fast nur innerhalb der anti - zionistischen Dachgruppe Mea Shearims, in der Edah HaCharedit. Obwohl Dushinsky relativ klein ist, hat die Gruppe einen enormen Einfluss in der Edah. Der Gründer der Gruppe, auch ein Rebbe namens Yosef Zvi Dushinsky (der Maharitz) fuhr im Jahre 1948 nach New York und versuchte die UNO zu überzeugen, keinen Staat Israel zuzulassen. Bis heute ist Dushinsky absolut anti - zionistisch.
Mehr zum Antizionismus hier:
http://hamantaschen.blogspot.com/2007/11/der-talmudisch-begrndete-antizionismus.html
Nach Dushinsky zogen wir durch die Yoel Street nach Mea Shearim. Obwohl es schon spät war, beschlossen wir, wenigstens noch bei der Chassidut Kretchnif Jerusalem vorbei zuschauen. Bei Kretchnif ist mehr Stimmung als bei Dushinsky und viele Chassidim, die wir vorher bei Dushinsky gesichtet hatten, standen nun am Tisch des Kretchnifer Rebben. Einschließlich des Sohnes des Kretchnifer Rebben.
Neben dem Rebben der Toldot Aharon Yitzchak ist der Kretchnifer Rebbe der beste Entertainer. Sein Tisch ist euphorisch und wer nicht mitmacht, wird vom Rebben persönlich angefeuert. Leider verpassten wir gestern den alleinigen Tanze des Rebben, doch waren wir gegenwärtig als er zusammen mit seinen Chassidim im Kreis tanzte. Dies ist die beste Show, denn vorher tanzen alle eintönig und sobald der Rebbe mit einstimmt, geht die Post ab. Dann kommt Stimmung und Bewegung in den Kreis.
Viele Frauen waren nicht oben auf der Empore. Nur die Rebbitzen und einige weibl. Familienangehörigen. Die Rebbitzen kam gegen Ende auf mich zu und wir unterhielten uns. Eines ist sicher; wenn ich Details ueber Kretchnif brauche und einen Ansprechpartner suche, steht sie zur Verfügung. Das hatten wir bisher noch nicht, dass sich eine Rebbitzen persönlich bereit erklärte. Sie ist eine etwas ältere Dame mit einem sehr guten Sinn für Humor.
Nach Kretchnif fuehrte unser Weg durch den Markt von Mea Shearim. Mittlerweile war es 2.00 Uhr frueh und viele Leute waren nicht mehr unterwegs. Leider fanden wir die Synagoge der Neturei Karta nicht und sind gezwungen eingehend zu fragen. Dafür fanden wir einige andere interessante Synagogen im Markt. Dann kam auch noch ein Krankenwagen mit Blaulicht langsam um die Ecke gebogen und sofort rannten zwei Chassidim der Avraham Yitzchak aus der Synagoge auf die Strasse hinaus. Normalerweise werden Autos am Schabbat gesteinigt, doch bei Ambulanzen geschieht nichts und die Chassidim zogen sich zurueck.
Der Markt von Mea Shearim ist eine Hochburg der Neturei Karta und die Grafittis zu lesen, ist immer recht lustig. "Zionisten Raus" und "Free Palestine" war zu lesen.
Alles in allem eine gelungene Tischnacht.
Freitag, Januar 11, 2008
Ein kalter Schabbat
B"H
Des nachts soll es Minusgrade geben, was meine Freundin und mich jedoch nicht von chassidischen Tischbesuchen abhält. Mal schauen, wo wir heute Abend landen. Viel Auswahl haben wir nicht, aber aufgeben tun wir nie.
Falls es einmal der Fall sein sollte, dass wir vor 1.00 Uhr nachts heimkommen, wären wir doch glatt in der Lage rechtzeitig aufzustehen und die Synagogen Mea Shearims zu besuchen. Das ist unser grosses Problem, wenn wir des nachts beim Tisch des Rebben durchmachen.
Eines aber steht heute ganz oben auf der Liste:
Die Synagoge der Neturei Karta, in der es auch eine Frauenempore gibt.
Nicht weit von der Neturei Karta befindet sich die Synagoge der kleinen geheimen anti - zionistischen Gruppe "Mishkenot HaRoim". Deren Synagoge steht nach wie vor auf meinem Plan ganz oben. Noch dazu, wo das Gruppenoberhaupt, Rabbi Chaim Rabinovitch, vergangenen Monat in den USA war und neue Gelder bekommen hat.
Die Mishkenot HaRoim mit dem bekannten Rabbi der Chassidut Dushinsky, Rabbi Avraham Yitzchak Ullmann, in der Mitte mit weissem Schal. Links von ihm Rabbi Chaim Rabinovitch.

Dann mal Schabbat Schalom an alle.
Des nachts soll es Minusgrade geben, was meine Freundin und mich jedoch nicht von chassidischen Tischbesuchen abhält. Mal schauen, wo wir heute Abend landen. Viel Auswahl haben wir nicht, aber aufgeben tun wir nie.
Falls es einmal der Fall sein sollte, dass wir vor 1.00 Uhr nachts heimkommen, wären wir doch glatt in der Lage rechtzeitig aufzustehen und die Synagogen Mea Shearims zu besuchen. Das ist unser grosses Problem, wenn wir des nachts beim Tisch des Rebben durchmachen.
Eines aber steht heute ganz oben auf der Liste:
Die Synagoge der Neturei Karta, in der es auch eine Frauenempore gibt.
Nicht weit von der Neturei Karta befindet sich die Synagoge der kleinen geheimen anti - zionistischen Gruppe "Mishkenot HaRoim". Deren Synagoge steht nach wie vor auf meinem Plan ganz oben. Noch dazu, wo das Gruppenoberhaupt, Rabbi Chaim Rabinovitch, vergangenen Monat in den USA war und neue Gelder bekommen hat.
Die Mishkenot HaRoim mit dem bekannten Rabbi der Chassidut Dushinsky, Rabbi Avraham Yitzchak Ullmann, in der Mitte mit weissem Schal. Links von ihm Rabbi Chaim Rabinovitch.

Dann mal Schabbat Schalom an alle.
Die Seilschaften des Rabbi Ovadiah Yosef
B"H
Ein Rabbiner kann nicht zwei Aufgaben haben. Weltliche Politik und Religion, das passt in den wenigstens Fällen zusammen. Bekanntlich ist die Politik ein schmutziges Geschäft und mit Thora kommt man in der Knesset kaum weiter.
Der ehemalige sephardische Oberrabbiner Rabbi Ovadiah Yosef hat schon viele Skandale hinter sich, die selten auf eine hohe Religiosität schliessen lassen. Es ist unbestreitbar, dass er eine großer jüdischer Gelehrter ist und vom Fach einiges versteht, wenn....
wenn, ja, wenn da nicht seine negative Veranlagung wäre, alles und jeden beherrschen zu müssen. Er will das Sagen haben und mitmischen in der israel. Politik. Seine Shass - Partei dient ihm als Knessetsprungbrett und Parteivorsitzender Eli Yishai als Marionette.
Rabbi Ovadiah

Seit Monaten greifen die aschkenazischen haredischen Tageszeitungen Shass und Yishai an. Shass befindet sich in der Olmert - Koalition, was bedeutet, dass sie auch einer Teilung des Landes sowie Jerusalems zustimmen würden, um in der Koalition zu verbleiben. Für aschkenazische Haredim ist Shass samt Anhang nur auf den persönlichen Vorteil bedacht und Mea Shearim läuft Sturm.
Was seit Monaten als übertrieben klang, wird nun mehr als bestätigt. Schon im Dezember machte eine Ausgabe der Zeitung "HaEdah" (herausgegeben von der anti - zionistischen Dachorganisation Edah HaCharedit) darauf aufmerksam.
Im Juni 2004 löste die damalige Regierung Sharon das Religionsministerium auf. Dies geschah auf Drängen des Koalitionspartners SHINUI und deren psychopathischen religionshassenden Vorsitzenden Tommy (Yosef) Lapid.
Von der Zeiterscheinung "Shinui" spricht heute niemand mehr und somit setzte der derzeitige Koalitionspartner Shass durch, dass das Religionsministerium wieder eingeführt wird. Ein Zusage der Regierung ist vorhanden und Rabbi Ovadiah macht schon seine Pläne, wie er alles unter seinen Machthebel bringen kann.
Zusätzlich soll es einen Oberrabbiner für Jerusalem geben und wer soll das wohl werden ?
Nein, nicht etwa Rabbi Ovadiah Yosef.
Aber seinen Sohn, Rabbi Yitzchak, will Vater Ovadiah schon gerne auf dem Pöstchen sehen. Und so werden Pläne geschmiedet und Seilschaften geschlossen.
Wer wirklich religiös ist, der sollte wissen, dass die Welt nicht nach dem Willen eines umstrittenen Mannes funktioniert. Wäre Rabbi Ovadiah aschkenazisch, dann täte ich schnell zur Neturei Karta flüchten.
Ein Rabbiner kann nicht zwei Aufgaben haben. Weltliche Politik und Religion, das passt in den wenigstens Fällen zusammen. Bekanntlich ist die Politik ein schmutziges Geschäft und mit Thora kommt man in der Knesset kaum weiter.
Der ehemalige sephardische Oberrabbiner Rabbi Ovadiah Yosef hat schon viele Skandale hinter sich, die selten auf eine hohe Religiosität schliessen lassen. Es ist unbestreitbar, dass er eine großer jüdischer Gelehrter ist und vom Fach einiges versteht, wenn....
wenn, ja, wenn da nicht seine negative Veranlagung wäre, alles und jeden beherrschen zu müssen. Er will das Sagen haben und mitmischen in der israel. Politik. Seine Shass - Partei dient ihm als Knessetsprungbrett und Parteivorsitzender Eli Yishai als Marionette.
Rabbi Ovadiah

Seit Monaten greifen die aschkenazischen haredischen Tageszeitungen Shass und Yishai an. Shass befindet sich in der Olmert - Koalition, was bedeutet, dass sie auch einer Teilung des Landes sowie Jerusalems zustimmen würden, um in der Koalition zu verbleiben. Für aschkenazische Haredim ist Shass samt Anhang nur auf den persönlichen Vorteil bedacht und Mea Shearim läuft Sturm.
Was seit Monaten als übertrieben klang, wird nun mehr als bestätigt. Schon im Dezember machte eine Ausgabe der Zeitung "HaEdah" (herausgegeben von der anti - zionistischen Dachorganisation Edah HaCharedit) darauf aufmerksam.
Im Juni 2004 löste die damalige Regierung Sharon das Religionsministerium auf. Dies geschah auf Drängen des Koalitionspartners SHINUI und deren psychopathischen religionshassenden Vorsitzenden Tommy (Yosef) Lapid.
Von der Zeiterscheinung "Shinui" spricht heute niemand mehr und somit setzte der derzeitige Koalitionspartner Shass durch, dass das Religionsministerium wieder eingeführt wird. Ein Zusage der Regierung ist vorhanden und Rabbi Ovadiah macht schon seine Pläne, wie er alles unter seinen Machthebel bringen kann.
Zusätzlich soll es einen Oberrabbiner für Jerusalem geben und wer soll das wohl werden ?
Nein, nicht etwa Rabbi Ovadiah Yosef.
Aber seinen Sohn, Rabbi Yitzchak, will Vater Ovadiah schon gerne auf dem Pöstchen sehen. Und so werden Pläne geschmiedet und Seilschaften geschlossen.
Wer wirklich religiös ist, der sollte wissen, dass die Welt nicht nach dem Willen eines umstrittenen Mannes funktioniert. Wäre Rabbi Ovadiah aschkenazisch, dann täte ich schnell zur Neturei Karta flüchten.
Donnerstag, Januar 10, 2008
Kurz gesagt - בקיצור
B"H
1. Jerusalem mit seinen haredischen (ultra - orthod.) Stadtteilen scheint fast ausgedient zu haben. Mea Shearim, Sanhedria, Kiryat Mattersdorf, Givat Shaul, wird dies irgendwann Vergangenheit werden ?
Wer die Inhalte haredischer Zeitungen mitverfolgt, dem fällt immer weider neu ins Auge, dass sich alles auf die Nachbarstadt Beit Shemesh versteift. Ganze chassidische Dynastien verlegen immer mehr ihren Wohnsitz dorthin.
Beit Shemesh ist kostengünstiger und ganze Stadtteile, besonders der chassidischen Gruppen wie Satmar, Dushinsky sowie Toldot Aharon, sind dort entstanden. Junge neuvermählte Chassidim bevorzugen Beit Shemesh der billigen Mieten wegen.
Aber so schnell wird die Bastion Jerusalem nun auch wieder nicht aufgegeben. Belz bleibt mit Sicherheit hier und Gur wird sich nicht unbedingt in die haredische Welt von Beit Shemesh werfen. Noch dazu, wo dort allem Anschein nach die Mitgliedergruppen der anti - zionistischen Dachorganisation Edah HaCharedit das Sagen haben.
2. Heute Abend (Donnerstag, 10. Januar 2008) findet eine Demo auf dem Kikar Zion (Zion Square) in der Jerusalemer Innenstadt statt. Plakate rufen zum zahlreichen Erscheinen auf und offiziell geht es um die Yahrzeit (Sterbegedenktag) des einstigen großen Rabbi aus der Negevstadt Netivot, dem marrok. Baba Sali (Rabbi Israel Abuchatzeira). Bei der Demo seien unter anderem auch bekannte israel. Rabbiner anwesend.
Was auf dem Plakat steht, ist mehr als relativ.
Denn was nicht zu sehen ist: der Veranstalter ist Chabad und Chabad gedenkt nicht unbedingt dem Baba Sali. Vielmehr wird die Demo am Zion Square zu einer Demo gegen den Besuch von George Bush umformiert.
In den Staaten wie auch in Israel spricht sich Chabad energisch gegen den Besuch aus, da es dabei um Landvergabe an die Palästinenser geht. Chabad gibt nicht unbedingt den Amerikanern die Schuld, sondern sieht die sekuläre israel. Regierung als den Hauptverursacher. Die Regierung Olmert sei unfähig und widerspreche jeglicher Thora.
Wer interessiert ist: Die Demo findet um 19.00 Uhr statt. Allerdings gehe ich davon aus, dass es sich bei ihr um eine illegale Veranstaltung handelt und man läuft eventuell Gefahr, verhaftet zu werden.
3. Alle paar Wochen veröffentlicht die oben erwähnte "Edah HaCharedit" ihre eigene Zeitung. Wer interessiert ist, kann die Ausgabe, die sich "HaEdah" nennt, in einem Buchladen im Markt von Mea Shearim für 6 Shekel (ca. 1, 20 Euro) erstehen. Der Buchladen sollte nur in angemessener relig. Kleidung betreten werden.
Die Zeitung erscheint in hebräischer Sprache und ist nicht uninteressant.
1. Jerusalem mit seinen haredischen (ultra - orthod.) Stadtteilen scheint fast ausgedient zu haben. Mea Shearim, Sanhedria, Kiryat Mattersdorf, Givat Shaul, wird dies irgendwann Vergangenheit werden ?
Wer die Inhalte haredischer Zeitungen mitverfolgt, dem fällt immer weider neu ins Auge, dass sich alles auf die Nachbarstadt Beit Shemesh versteift. Ganze chassidische Dynastien verlegen immer mehr ihren Wohnsitz dorthin.
Beit Shemesh ist kostengünstiger und ganze Stadtteile, besonders der chassidischen Gruppen wie Satmar, Dushinsky sowie Toldot Aharon, sind dort entstanden. Junge neuvermählte Chassidim bevorzugen Beit Shemesh der billigen Mieten wegen.
Aber so schnell wird die Bastion Jerusalem nun auch wieder nicht aufgegeben. Belz bleibt mit Sicherheit hier und Gur wird sich nicht unbedingt in die haredische Welt von Beit Shemesh werfen. Noch dazu, wo dort allem Anschein nach die Mitgliedergruppen der anti - zionistischen Dachorganisation Edah HaCharedit das Sagen haben.
2. Heute Abend (Donnerstag, 10. Januar 2008) findet eine Demo auf dem Kikar Zion (Zion Square) in der Jerusalemer Innenstadt statt. Plakate rufen zum zahlreichen Erscheinen auf und offiziell geht es um die Yahrzeit (Sterbegedenktag) des einstigen großen Rabbi aus der Negevstadt Netivot, dem marrok. Baba Sali (Rabbi Israel Abuchatzeira). Bei der Demo seien unter anderem auch bekannte israel. Rabbiner anwesend.
Was auf dem Plakat steht, ist mehr als relativ.
Denn was nicht zu sehen ist: der Veranstalter ist Chabad und Chabad gedenkt nicht unbedingt dem Baba Sali. Vielmehr wird die Demo am Zion Square zu einer Demo gegen den Besuch von George Bush umformiert.
In den Staaten wie auch in Israel spricht sich Chabad energisch gegen den Besuch aus, da es dabei um Landvergabe an die Palästinenser geht. Chabad gibt nicht unbedingt den Amerikanern die Schuld, sondern sieht die sekuläre israel. Regierung als den Hauptverursacher. Die Regierung Olmert sei unfähig und widerspreche jeglicher Thora.
Wer interessiert ist: Die Demo findet um 19.00 Uhr statt. Allerdings gehe ich davon aus, dass es sich bei ihr um eine illegale Veranstaltung handelt und man läuft eventuell Gefahr, verhaftet zu werden.
3. Alle paar Wochen veröffentlicht die oben erwähnte "Edah HaCharedit" ihre eigene Zeitung. Wer interessiert ist, kann die Ausgabe, die sich "HaEdah" nennt, in einem Buchladen im Markt von Mea Shearim für 6 Shekel (ca. 1, 20 Euro) erstehen. Der Buchladen sollte nur in angemessener relig. Kleidung betreten werden.
Die Zeitung erscheint in hebräischer Sprache und ist nicht uninteressant.
Labels:
Jerusalem
Parashat Bo
B"H
Die Thoralesung für diesen Schabbat
Die dieswöchige Thoralesung fällt etwas anders aus wie gewohnt, da ich zwar kurz zwei der insgesamt zehn Plagen anschneide; ansonsten mich aber nur auf ein Thema beschränke, welches sich durch die gesamte Thora zieht und uns bis heute begleitet. Gemeint sind die EREV RAV, welche in der Parashat Bo zum ersten Mal Erwähnung finden. Die "Erev Rav" sind vorwiegend ein kabbalistisches Thema und von daher wird diese Parasha etwas kabbalistisch.
Die vergangene Parasha, Parashat Va'era, schloß mit der Beschreibung der Plage des Hagels. Vielen Kommentatoren, darunter auch Rabbi Samson Raphael Hirsch, fiel auf, dass die Thora uns nicht sagt, dass der Hagel gänzlich verschwand. Stattdessen heißt es, dass er stoppte.
Wieso stoppte er nur ?
Rabbi Hirsch kommentiert, dass der Hagel in der Luft stoppte und dort bestehen blieb.
Warum aber kam der Hagel nicht als Regen herab ? Kann er nur einfach so in der Luft stehenbleiben ?
Nichts geschah und weitere Kommentatoren sind der Meinung, dass sich der Hagel immer noch in der Luft befindet und von G - tt als Waffe im Krieg von Gog und Magog gegen jene Völker eingesetzt wird, welche sich gegen Israel erheben.
In der dieswöchigen Thoralesung folgen die Heuschrecken - sowie die Plage der Dunkelheit. Dazu heißt es recht seltsamerweise in der Thora, dass die ersten drei Tage der Dunkelheit kein Ägypter in der Lage war, etwas zu sehen. Darauf wird uns jedoch mitgeteilt, dass die folgenden drei Tage kein Ägypter in der Lage war, sich auch nur zu bewegen.
Der Ramban (Nachmanides) sagt, dass die Dunkelheit keineswegs so zu verstehen sei, dass da die Sonne nicht schien oder sie verdeckt war. Vielmehr kam diese unvorstellbare Dunkelheit direkt von G - tt und war so konzentriert, dass sie sogar jede Kerze erlöschen ließ. Die Midrash Rabbah nennt zwei Gründe für die Plage der Dunkelheit.
Während die Ägypter ausgeschaltet waren, sahen die Israeliten genug. So gingen sie in die Häuser der Ägypter und schauten, wo deren Juwelen versteckt lagen. Mit dem Auszug aus Ägypten nämlich forderten sie von ihren Skalvenhaltern den ausstehenden Lohn für all die Jahre und natürlich wollten die ägyptischen Herrschaften nichts zahlen und behaupteten, sie hätten kein Geld. Und so machten sich die Israeliten auf und nahmen sich, was ihnen zustand.
Der zweite, weniger bekannte Grund, den die Midrash Rabbah diesbezüglich nennt ist, dass es schon zu der Zeit Israeliten (Juden) gab, welche sich so sehr assimiliert hatten, dass für sie ein Auszug aus Ägypten nicht mehr möglich war. Deshalb beschloß G - tt, diese Juden zu töten. Die Dunkelheit sollte den Ägyptern die Tatsache verbergen, dass da Menschen starben, denn hinterher hätten sie hämisch behaupten können, dass der G - tt der Juden ja sein eigenes Volk umbringe.
Insgesamt ist hier zu erwähnen, dass es talmudische Konzepte gibt, welche über verschiedene Gruppen von Juden Auskunft geben, inwieweit sich jemand assimilieren darf, um hinterher dennoch eine akzeptierte Teshuva (Umkehr zu G - tt) bekommen zu können. Wie weit darf sich jein Jude von G - tt und den Mitzwot entfernen ?
Vielleicht eine kleine Anregung, etwas tiefer über individuelle Handlungen nachzudenken.
Aber nun zum eigentlichen Thema der Parasha, nämlich der EREV RAV, welche auf Englisch "Mixed Multitude" genannt wird. Wer sind sie und wo liegt ihr eigentlicher Ursprung ?
An sich sind die Erev Rav einen eigenen Artikel oder ein ganzes Buch wert. Thorakommentatoren gehen weniger auf sie ein als der Talmud und die Kabbalah.
In der Thora (Exodus 12:38) heißt es, dass neben den Israeliten auch die Erev Rav Ägypten verließ. Rashi sagt lediglich, dass es sich hierbei um ägyptische Konvertiten zum Judentum handele.
Die folgenden Berichte sind sowohl aus Quellen des litvish - haredischen Kabbalahverständnis (aus der Schule des Vilna Gaon) als auch aus der chassidischen Schule des Kabbalahverständnisses. Beide Gruppen legen die Kabbalah des großen Kabbalisten, Rabbi Yitzchak Luria 1534 - 1572, in gewissen Themenbereichen unterschiedlich aus. Des Weiteren nenne ich Meinungen aus dem manchmal umstrittenen Buch "Emek HaMelech" (ein Kommentar zu den Schriften des Rabbi Y. Luria). Die Quellen sind jedoch von geringer Bedeutung, denn fast alle stimmen dem allgemeinen Bild von der Erev Rav zu.
Moshe entschied sich gegen den Willen G - ttes, unaufrichtige Konvertiten mit aus Ägypten zu nehmen. G - tt selbst warnte ihn zuvor, dass diese erheblich hohe Bevölkerungsgruppe unentwegt Probleme bereiten wird. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass es fortwährend die Erev Rav waren, welche die Israeliten aufstachelten, gegen G - tt zu rebellieren. Unter anderem waren sie ebenso für den Bau des Goldenen Kalbes verantwortlich.
Aber nicht nur beim Marsch durch die Wüste erwiesen sich die Erev Rav als Plage. Da sie sich nach dem Einzug in das Land Israel mit den Juden vermischten, gibt es sie bis heute in unserem Volk. Der Gaon aus Vilna unterscheidet fünf Gruppen innerhalb der Erev Rav und es heißt, dass nicht der Kampf gegen die Ischmaeliten der größte Hinderungsgrund für das Eintreffen des Meschiach sei, sondern der jüdische Kampf gegen die Erev Rav. Ein interner Kampf innerhalb des jüdischen Volkes, von dem wir heute schon einiges sehen. Immer wieder stacheln Juden andere Juden an, sich von G - tt loszulösen und doch lieber machen sollen, was sie wollen. Aber nicht nur das; auch Rabbiner teilt der Vilna Gaon den Erev Rav zu. Nämlich all jene, die nur auf ihren eigenen Ruf bzw. Vorteil aus sind, andere Leute ausnutzen und die Thora falsch lehren. Laut dem Gaon aus Vilna wird es unsere größte Herausforderung sein, die Erev Rav zu besiegen.
Kommentare zu den Erev Rav:
"Jegliche Diaspora sowie die Tempelzerstörungen gehen auf das Konto der Erev Rav" (Tikunei HaZohar).
"Die Erev Rav schädigen Israel mehr als jede andere Nation" (Rabbi Simcha Yissachar Halberstam).
"Moshes Ziel war, die Erev Rav auf den richtigen Pfad zu führen, doch er scheiterte. Heutzutage sind die Erev Rav führende jüdische Persönlichkeiten, doch der Meschiach, welcher einen Funken von Moshe enthält, wird sie schließlich besiegen" (Bnei Yissachar).
Wie schon zuvor erwähnt, waren die Erev Rav unaufrichtige ägyptische Konvertiten. Viele sind der Meinung, dass diese selbst Sklaven waren und sahen, dass die Israeliten einmal die Skalverei verlassen und in ihr eigenes Land zurückkehren werden. Genau darin sahen die Erev Rav ihren Vorteil, denn auch sie wollten ihre Freiheit. So kam das Judentum ihnen gerade recht. Übrigens sehen wir in der Geschichte (bis in die heutige Zeit hinein), dass es immer wieder Leute gab / gibt, die aus dem eigenen Vorteil heraus zum Judentum konvertierten. Zu Zeiten König Davids sowie seines Sohnes, König Salomons, gab es jedoch keine Konvertiten zum Judentum. Auch wird es diese nach dem Eintreffen des Meschiach nicht mehr geben.
Beim Marsch durch die Wüste standen die Erev Rav gesellschaftlich unter den Israeliten und bekamen auch kein Manna vom Himmel. Stattdessen aßen sie die Reste der anderen. Auch mußten sie dem Marsch hinterherlaufen und waren nie vorne mit dabei. Mischehen gab es zu der Zeit keine, sondern erst im Lande Israel als viele den Überblick verloren, wer wer ist. So gelang es den Erev Rav schließlich im jüdischen Volk unterzutauchen.
Woher aber kamen diese Erev Rav und wieso ließ G - tt dies alles zu ?
Der Talmud Traktat Chagigah 13b - 14a gibt uns Auskunft. Das eigentlich Konzept basiert auf einen Psalmenvers (105:8), wo geschrieben steht, dass G - tt den Juden die Thora nach 1000 Generationen geben wird.
Nach 1000 Generationen ?
Tatsache aber ist, dass die Juden die Thora schon nach 26 Generationen erhielten. Fehlen da nicht 974 Generationen ? Wo sind diese hin entschwunden ?
Im Talmud Chagigah sowie in unzähligen kabbalistischen Schriften steht, dass G - tt vor der Welterschaffung 1000 Generationen von Seelen erschuf. Dieses ist wieder einmal mehr als Metapher zu verstehen und NICHT wörtlich zu nehmen. "Erschuf" heißt hier "in Seinen Gedanken" und nicht, dass die Seelen physisch existierten. G - tt "dachte" nur an deren Erschaffung. Seither werden jene Seelen in jede Generation gepflanzt mit der Aufgabe, sich zu perfektionieren. Bisher schlug das meistens fehl und somit wurden sie immer wieder aufs Neue reinkarniert. Meinungen besagen, dass der Meschiach erst dann eintrifft, wenn all diese Seelen perfektioniert sind.
Die Seelen der Erev Rav wurden in mehreren Generationen reinkarniert. So in der Generation des Enosch, in der Generation von Noach, in der Generation von Sodom und später in der Generation, welche mit Moshe durch die Wüste marschierte.
Und so setzt sich die Liste der Erev Rav - Seelen bis heute fort. Identifizieren kann sie heute niemand mehr außer G - tt selber. Der Letzte, der dazu in der Lage war, war Rabbi Yitzchak Luria und vielleicht später noch der Baal Shem Tov. Heutzutage gibt es keinen so großen Kabbalisten mehr, der überhaupt zu Seelendeutungen in der Lage ist. Spätestens in der Zeit des Meschiach wird sich alles aufklären.
Wieso läßt G - tt soetwas zu ?
Er selber hatte alles ganz anders geplant, aber da Adam Und Eva (Chava) im Paradies von einem Baum aßen, von dem sie nicht hätten essen sollen, wurden sie sich ihres freien Willens bewußt und nutzten ihn ausgiebig aus. Die in Adam enthaltetenen Seelen hätten ursprünglich perfektioniert werden sollen, doch Adam entschloß sich anders.
Wozu gab es überhaupt 10 Plagen ? Hätte nicht eine ausgereicht ?
Auch zu dieser Frage gibt es ausgiebige kabbalistische sowie chassidische Erklärungen, die ich aber auslasse. Stattdessen nenne ich eine Meinung des derzeitigen Rebben der chassidischen Gruppe Slonim aus Jerusalem, Rabbi Shmuel Bozorowsky. G - tt wollte den Israeliten bewußt machen, dass es Ihn gibt und Er der alleinige einzige G - tt über jede Schöpfung ist. Und dieses Ziel erkannten die oft assimilierten und teilweise frustrierten Israeliten nicht immer sofort.
Schabbat Schalom
Die Thoralesung für diesen Schabbat
Die dieswöchige Thoralesung fällt etwas anders aus wie gewohnt, da ich zwar kurz zwei der insgesamt zehn Plagen anschneide; ansonsten mich aber nur auf ein Thema beschränke, welches sich durch die gesamte Thora zieht und uns bis heute begleitet. Gemeint sind die EREV RAV, welche in der Parashat Bo zum ersten Mal Erwähnung finden. Die "Erev Rav" sind vorwiegend ein kabbalistisches Thema und von daher wird diese Parasha etwas kabbalistisch.
Die vergangene Parasha, Parashat Va'era, schloß mit der Beschreibung der Plage des Hagels. Vielen Kommentatoren, darunter auch Rabbi Samson Raphael Hirsch, fiel auf, dass die Thora uns nicht sagt, dass der Hagel gänzlich verschwand. Stattdessen heißt es, dass er stoppte.
Wieso stoppte er nur ?
Rabbi Hirsch kommentiert, dass der Hagel in der Luft stoppte und dort bestehen blieb.
Warum aber kam der Hagel nicht als Regen herab ? Kann er nur einfach so in der Luft stehenbleiben ?
Nichts geschah und weitere Kommentatoren sind der Meinung, dass sich der Hagel immer noch in der Luft befindet und von G - tt als Waffe im Krieg von Gog und Magog gegen jene Völker eingesetzt wird, welche sich gegen Israel erheben.
In der dieswöchigen Thoralesung folgen die Heuschrecken - sowie die Plage der Dunkelheit. Dazu heißt es recht seltsamerweise in der Thora, dass die ersten drei Tage der Dunkelheit kein Ägypter in der Lage war, etwas zu sehen. Darauf wird uns jedoch mitgeteilt, dass die folgenden drei Tage kein Ägypter in der Lage war, sich auch nur zu bewegen.
Der Ramban (Nachmanides) sagt, dass die Dunkelheit keineswegs so zu verstehen sei, dass da die Sonne nicht schien oder sie verdeckt war. Vielmehr kam diese unvorstellbare Dunkelheit direkt von G - tt und war so konzentriert, dass sie sogar jede Kerze erlöschen ließ. Die Midrash Rabbah nennt zwei Gründe für die Plage der Dunkelheit.
Während die Ägypter ausgeschaltet waren, sahen die Israeliten genug. So gingen sie in die Häuser der Ägypter und schauten, wo deren Juwelen versteckt lagen. Mit dem Auszug aus Ägypten nämlich forderten sie von ihren Skalvenhaltern den ausstehenden Lohn für all die Jahre und natürlich wollten die ägyptischen Herrschaften nichts zahlen und behaupteten, sie hätten kein Geld. Und so machten sich die Israeliten auf und nahmen sich, was ihnen zustand.
Der zweite, weniger bekannte Grund, den die Midrash Rabbah diesbezüglich nennt ist, dass es schon zu der Zeit Israeliten (Juden) gab, welche sich so sehr assimiliert hatten, dass für sie ein Auszug aus Ägypten nicht mehr möglich war. Deshalb beschloß G - tt, diese Juden zu töten. Die Dunkelheit sollte den Ägyptern die Tatsache verbergen, dass da Menschen starben, denn hinterher hätten sie hämisch behaupten können, dass der G - tt der Juden ja sein eigenes Volk umbringe.
Insgesamt ist hier zu erwähnen, dass es talmudische Konzepte gibt, welche über verschiedene Gruppen von Juden Auskunft geben, inwieweit sich jemand assimilieren darf, um hinterher dennoch eine akzeptierte Teshuva (Umkehr zu G - tt) bekommen zu können. Wie weit darf sich jein Jude von G - tt und den Mitzwot entfernen ?
Vielleicht eine kleine Anregung, etwas tiefer über individuelle Handlungen nachzudenken.
Aber nun zum eigentlichen Thema der Parasha, nämlich der EREV RAV, welche auf Englisch "Mixed Multitude" genannt wird. Wer sind sie und wo liegt ihr eigentlicher Ursprung ?
An sich sind die Erev Rav einen eigenen Artikel oder ein ganzes Buch wert. Thorakommentatoren gehen weniger auf sie ein als der Talmud und die Kabbalah.
In der Thora (Exodus 12:38) heißt es, dass neben den Israeliten auch die Erev Rav Ägypten verließ. Rashi sagt lediglich, dass es sich hierbei um ägyptische Konvertiten zum Judentum handele.
Die folgenden Berichte sind sowohl aus Quellen des litvish - haredischen Kabbalahverständnis (aus der Schule des Vilna Gaon) als auch aus der chassidischen Schule des Kabbalahverständnisses. Beide Gruppen legen die Kabbalah des großen Kabbalisten, Rabbi Yitzchak Luria 1534 - 1572, in gewissen Themenbereichen unterschiedlich aus. Des Weiteren nenne ich Meinungen aus dem manchmal umstrittenen Buch "Emek HaMelech" (ein Kommentar zu den Schriften des Rabbi Y. Luria). Die Quellen sind jedoch von geringer Bedeutung, denn fast alle stimmen dem allgemeinen Bild von der Erev Rav zu.
Moshe entschied sich gegen den Willen G - ttes, unaufrichtige Konvertiten mit aus Ägypten zu nehmen. G - tt selbst warnte ihn zuvor, dass diese erheblich hohe Bevölkerungsgruppe unentwegt Probleme bereiten wird. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass es fortwährend die Erev Rav waren, welche die Israeliten aufstachelten, gegen G - tt zu rebellieren. Unter anderem waren sie ebenso für den Bau des Goldenen Kalbes verantwortlich.
Aber nicht nur beim Marsch durch die Wüste erwiesen sich die Erev Rav als Plage. Da sie sich nach dem Einzug in das Land Israel mit den Juden vermischten, gibt es sie bis heute in unserem Volk. Der Gaon aus Vilna unterscheidet fünf Gruppen innerhalb der Erev Rav und es heißt, dass nicht der Kampf gegen die Ischmaeliten der größte Hinderungsgrund für das Eintreffen des Meschiach sei, sondern der jüdische Kampf gegen die Erev Rav. Ein interner Kampf innerhalb des jüdischen Volkes, von dem wir heute schon einiges sehen. Immer wieder stacheln Juden andere Juden an, sich von G - tt loszulösen und doch lieber machen sollen, was sie wollen. Aber nicht nur das; auch Rabbiner teilt der Vilna Gaon den Erev Rav zu. Nämlich all jene, die nur auf ihren eigenen Ruf bzw. Vorteil aus sind, andere Leute ausnutzen und die Thora falsch lehren. Laut dem Gaon aus Vilna wird es unsere größte Herausforderung sein, die Erev Rav zu besiegen.
Kommentare zu den Erev Rav:
"Jegliche Diaspora sowie die Tempelzerstörungen gehen auf das Konto der Erev Rav" (Tikunei HaZohar).
"Die Erev Rav schädigen Israel mehr als jede andere Nation" (Rabbi Simcha Yissachar Halberstam).
"Moshes Ziel war, die Erev Rav auf den richtigen Pfad zu führen, doch er scheiterte. Heutzutage sind die Erev Rav führende jüdische Persönlichkeiten, doch der Meschiach, welcher einen Funken von Moshe enthält, wird sie schließlich besiegen" (Bnei Yissachar).
Wie schon zuvor erwähnt, waren die Erev Rav unaufrichtige ägyptische Konvertiten. Viele sind der Meinung, dass diese selbst Sklaven waren und sahen, dass die Israeliten einmal die Skalverei verlassen und in ihr eigenes Land zurückkehren werden. Genau darin sahen die Erev Rav ihren Vorteil, denn auch sie wollten ihre Freiheit. So kam das Judentum ihnen gerade recht. Übrigens sehen wir in der Geschichte (bis in die heutige Zeit hinein), dass es immer wieder Leute gab / gibt, die aus dem eigenen Vorteil heraus zum Judentum konvertierten. Zu Zeiten König Davids sowie seines Sohnes, König Salomons, gab es jedoch keine Konvertiten zum Judentum. Auch wird es diese nach dem Eintreffen des Meschiach nicht mehr geben.
Beim Marsch durch die Wüste standen die Erev Rav gesellschaftlich unter den Israeliten und bekamen auch kein Manna vom Himmel. Stattdessen aßen sie die Reste der anderen. Auch mußten sie dem Marsch hinterherlaufen und waren nie vorne mit dabei. Mischehen gab es zu der Zeit keine, sondern erst im Lande Israel als viele den Überblick verloren, wer wer ist. So gelang es den Erev Rav schließlich im jüdischen Volk unterzutauchen.
Woher aber kamen diese Erev Rav und wieso ließ G - tt dies alles zu ?
Der Talmud Traktat Chagigah 13b - 14a gibt uns Auskunft. Das eigentlich Konzept basiert auf einen Psalmenvers (105:8), wo geschrieben steht, dass G - tt den Juden die Thora nach 1000 Generationen geben wird.
Nach 1000 Generationen ?
Tatsache aber ist, dass die Juden die Thora schon nach 26 Generationen erhielten. Fehlen da nicht 974 Generationen ? Wo sind diese hin entschwunden ?
Im Talmud Chagigah sowie in unzähligen kabbalistischen Schriften steht, dass G - tt vor der Welterschaffung 1000 Generationen von Seelen erschuf. Dieses ist wieder einmal mehr als Metapher zu verstehen und NICHT wörtlich zu nehmen. "Erschuf" heißt hier "in Seinen Gedanken" und nicht, dass die Seelen physisch existierten. G - tt "dachte" nur an deren Erschaffung. Seither werden jene Seelen in jede Generation gepflanzt mit der Aufgabe, sich zu perfektionieren. Bisher schlug das meistens fehl und somit wurden sie immer wieder aufs Neue reinkarniert. Meinungen besagen, dass der Meschiach erst dann eintrifft, wenn all diese Seelen perfektioniert sind.
Die Seelen der Erev Rav wurden in mehreren Generationen reinkarniert. So in der Generation des Enosch, in der Generation von Noach, in der Generation von Sodom und später in der Generation, welche mit Moshe durch die Wüste marschierte.
Und so setzt sich die Liste der Erev Rav - Seelen bis heute fort. Identifizieren kann sie heute niemand mehr außer G - tt selber. Der Letzte, der dazu in der Lage war, war Rabbi Yitzchak Luria und vielleicht später noch der Baal Shem Tov. Heutzutage gibt es keinen so großen Kabbalisten mehr, der überhaupt zu Seelendeutungen in der Lage ist. Spätestens in der Zeit des Meschiach wird sich alles aufklären.
Wieso läßt G - tt soetwas zu ?
Er selber hatte alles ganz anders geplant, aber da Adam Und Eva (Chava) im Paradies von einem Baum aßen, von dem sie nicht hätten essen sollen, wurden sie sich ihres freien Willens bewußt und nutzten ihn ausgiebig aus. Die in Adam enthaltetenen Seelen hätten ursprünglich perfektioniert werden sollen, doch Adam entschloß sich anders.
Wozu gab es überhaupt 10 Plagen ? Hätte nicht eine ausgereicht ?
Auch zu dieser Frage gibt es ausgiebige kabbalistische sowie chassidische Erklärungen, die ich aber auslasse. Stattdessen nenne ich eine Meinung des derzeitigen Rebben der chassidischen Gruppe Slonim aus Jerusalem, Rabbi Shmuel Bozorowsky. G - tt wollte den Israeliten bewußt machen, dass es Ihn gibt und Er der alleinige einzige G - tt über jede Schöpfung ist. Und dieses Ziel erkannten die oft assimilierten und teilweise frustrierten Israeliten nicht immer sofort.
Schabbat Schalom
Labels:
Kabbalah,
Rabbis,
Talmud,
Thora Parasha
Mittwoch, Januar 09, 2008
Segen vor dem Essen
B"H
Im Judentum haben wir die Halacha, vor und nach dem Essen einen Segen zu sagen.
Wer nicht gerade religiös aufwächst oder zum orthodoxen Judentum konvertiert, der wird ein Lied davon singen können, wie kompliziert es am Anfang sein kann, all die Segen auswendig zu lernen.
Aber nicht nur vor und nach dem Essen sagen wir Segen; genauso tun wir dies, vor einer Reise, nach einer überstandenen Krankheit oder Gefahr, bei Blitz und Donner, wenn 600.000 Juden zusammen an einem Ort sind, wenn wir duftende Pflanzen riechen, einen Regenbogen oder einen König sehen.
Die Anzahl der 600.000 Juden bezieht sich auf jene 600.000 Juden, die mit Moshe vor dem Berg Sinai standen. In allen anderen Segen, einschließlich der des Essens, erkennen wir G - ttes Größe an und das Er für alles auf der Welt zuständig ist.
An dieser Stelle möchte ich vorerst nur die Bedeutung der Segen vor und nach dem Essen / Trinken erwähnen. Nicht jeden einzelnen Segen und die entsprechende Halacha, denn jeder einzelne Segen ist ein eigenes Kapitel für sich.
Wir danken G - tt vor und nach dem Essen bzw. Trinken, weil wir damit anerkennen, dass Er uns die Nahrung gegeben hat. Viele werden meinen, dass wenn ich arbeite und Geld verdiene, ich mir selbstverständlich etwas zu Essen kaufen kann. Ist das dann nicht mein Verdienst ?
Im Judentum wird dies wieder einmal anders betrachtet, denn wer hat uns überhaupt erschaffen und wem haben wir unseren Job zu verdanken ? Vielleicht haben wir uns um die Stelle beworben und arbeiten, aber wem haben wir unsere körperliche Kraft zu verdanken ? Dass wir gesund sind, arbeiten und Geld verdienen können ? Und wer läßt das Getreide wachsen ?
Alles geht von G - tt aus und alles, was uns im Leben wiederfährt, wurde von Ihm bis ins kleinste Detail geplant. Selbst, welche Menschen wir während unseres Lebens treffen. Demzufolge bildet das Essen keine Ausnahme und wir danken G - tt vor und nach dem Essen, da wir nie etwas für Selbstverständlich im Leben nehmen sollten.
Die Mishna (mündl. Überlieferung G - ttes an Moshe am Berg Sinai) sowie die Gemara (rabbinische Diskussionen) im Talmud Traktat Berachot 35a ff. gehen detailliert auf die Bedeutung der verschiedenen Segen ein. Wir haben nicht nur einen gemeinsamen Segen vor und nach dem Essen, sondern mehrere unterschiedliche. Hierbei wird unterschieden, ob die Nahrung in der Erde wuchs, auf dem Baum oder sonstiger Herstellungsart war. Das Gleiche gilt für die Segen nach dem Essen. Zum Beispiel haben Gurken einen anderen Segen als Tomaten, beide haben aber den gleichen Segen nach dem Essen.
Brot hat einen anderen Segen als Kuchen (wobei es auf die Kuchenmenge ankommt). Nudeln sind ein Getreideprodukt und fallen somit unter den Segen der Kuchen. Weiterhin zu beachten sei, dass die sephardischen Juden ab und an einen anderen Segen haben als die aschkenazischen Juden. Berühmtes Beispiel hierfür ist der Reis. Sephardische Juden sagen vor dem Essen von Reis den Segen für Mezonot (u.a. Kuchen). Aschkenazim dagegen betrachten den Reis als "She HaKol" (ein eher allgemeiner Segen). Nach dem Essen jedoch sind sich Aschkenazim und Sepharadim wieder einige und sagen "Boreh Nefashot" (allgemeinen Segen nach dem Essen).
Rabbi Akiva sagt in der Gemara Berachot 35a, dass es einer Person verboten ist, etwas zu essen ohne vorher einen Segen gesprochen zu haben.
Allgemein heisst es im Judentum, dass wer etwas ohne Segen zu sich nimmt, ein Dieb ist (siehe die Gemara in Berachot 35a / b).
Warum ein Dieb ?
Weil er etwas von G - tt stiehlt, ohne Ihm dafür gedankt zu haben. Genauso wie Adam und Chava (Eva) als sie vom Baum der Erkenntnis (Etz HaDaat) im Paradies aßen.
In der Kabbalah haben die Segen eine noch ganz andere Bedeutung, denn dort geht es um Reinkarnationen (siehe Shaar HaGilgulim von Rabbi Yitzchak Luria). Zu dem Thema werde ich mehr auf meinem Kabbalah - Blog erläutern. Aber vorerst nur soviel, dass es zu dem Thema noch weitere Interpretationen gibt.
Warum sagen Juden einen weiteren Segen nach dem Essen / Trinken ? Reicht ein Segen vorher nicht aus ?
Rabbi Mordechai Machlis hatte hierzu einmal einen treffenden Kommentar. Vor dem Essen sind wir hungrig oder durstig und würden alles sagen, nur um uns zu sättigen. Nach dem Essen aber ist es viel schwerer einen Segen zu sagen, denn wer denkt schon an G - tt, wenn er alles hat ? Zu oft wird nur an G - tt gedacht, wenn etwas fehlt.
Wer relig. wird, den trifft oft der Schlag, wenn er die Vielzahl der Segen sieht. Zuerst ist es sicher nervig, das alles neu zu erlernen und zu behalten. Ist die Frucht nun vom Baum oder aus der Erde, ist es überhaupt eine Frucht und wie verändert sich der Segen, wenn Obst oder Gemüse weiterverarbeitet bzw. gekocht werden ?
Wer soll da noch durchsteigen ?
Wer jedoch erst einmal mit dem Lernen beginnt, der gewöhnt sich unglaublich schnell daran und vergißt nach einiger Zeit nicht mehr, die Segen zu sagen.
Eine Liste für jegliches Essen und dessen erforderliche Segen:
http://brochot.tripod.com/foods/index.htm
Im Judentum haben wir die Halacha, vor und nach dem Essen einen Segen zu sagen.
Wer nicht gerade religiös aufwächst oder zum orthodoxen Judentum konvertiert, der wird ein Lied davon singen können, wie kompliziert es am Anfang sein kann, all die Segen auswendig zu lernen.
Aber nicht nur vor und nach dem Essen sagen wir Segen; genauso tun wir dies, vor einer Reise, nach einer überstandenen Krankheit oder Gefahr, bei Blitz und Donner, wenn 600.000 Juden zusammen an einem Ort sind, wenn wir duftende Pflanzen riechen, einen Regenbogen oder einen König sehen.
Die Anzahl der 600.000 Juden bezieht sich auf jene 600.000 Juden, die mit Moshe vor dem Berg Sinai standen. In allen anderen Segen, einschließlich der des Essens, erkennen wir G - ttes Größe an und das Er für alles auf der Welt zuständig ist.
An dieser Stelle möchte ich vorerst nur die Bedeutung der Segen vor und nach dem Essen / Trinken erwähnen. Nicht jeden einzelnen Segen und die entsprechende Halacha, denn jeder einzelne Segen ist ein eigenes Kapitel für sich.
Wir danken G - tt vor und nach dem Essen bzw. Trinken, weil wir damit anerkennen, dass Er uns die Nahrung gegeben hat. Viele werden meinen, dass wenn ich arbeite und Geld verdiene, ich mir selbstverständlich etwas zu Essen kaufen kann. Ist das dann nicht mein Verdienst ?
Im Judentum wird dies wieder einmal anders betrachtet, denn wer hat uns überhaupt erschaffen und wem haben wir unseren Job zu verdanken ? Vielleicht haben wir uns um die Stelle beworben und arbeiten, aber wem haben wir unsere körperliche Kraft zu verdanken ? Dass wir gesund sind, arbeiten und Geld verdienen können ? Und wer läßt das Getreide wachsen ?
Alles geht von G - tt aus und alles, was uns im Leben wiederfährt, wurde von Ihm bis ins kleinste Detail geplant. Selbst, welche Menschen wir während unseres Lebens treffen. Demzufolge bildet das Essen keine Ausnahme und wir danken G - tt vor und nach dem Essen, da wir nie etwas für Selbstverständlich im Leben nehmen sollten.
Die Mishna (mündl. Überlieferung G - ttes an Moshe am Berg Sinai) sowie die Gemara (rabbinische Diskussionen) im Talmud Traktat Berachot 35a ff. gehen detailliert auf die Bedeutung der verschiedenen Segen ein. Wir haben nicht nur einen gemeinsamen Segen vor und nach dem Essen, sondern mehrere unterschiedliche. Hierbei wird unterschieden, ob die Nahrung in der Erde wuchs, auf dem Baum oder sonstiger Herstellungsart war. Das Gleiche gilt für die Segen nach dem Essen. Zum Beispiel haben Gurken einen anderen Segen als Tomaten, beide haben aber den gleichen Segen nach dem Essen.
Brot hat einen anderen Segen als Kuchen (wobei es auf die Kuchenmenge ankommt). Nudeln sind ein Getreideprodukt und fallen somit unter den Segen der Kuchen. Weiterhin zu beachten sei, dass die sephardischen Juden ab und an einen anderen Segen haben als die aschkenazischen Juden. Berühmtes Beispiel hierfür ist der Reis. Sephardische Juden sagen vor dem Essen von Reis den Segen für Mezonot (u.a. Kuchen). Aschkenazim dagegen betrachten den Reis als "She HaKol" (ein eher allgemeiner Segen). Nach dem Essen jedoch sind sich Aschkenazim und Sepharadim wieder einige und sagen "Boreh Nefashot" (allgemeinen Segen nach dem Essen).
Rabbi Akiva sagt in der Gemara Berachot 35a, dass es einer Person verboten ist, etwas zu essen ohne vorher einen Segen gesprochen zu haben.
Allgemein heisst es im Judentum, dass wer etwas ohne Segen zu sich nimmt, ein Dieb ist (siehe die Gemara in Berachot 35a / b).
Warum ein Dieb ?
Weil er etwas von G - tt stiehlt, ohne Ihm dafür gedankt zu haben. Genauso wie Adam und Chava (Eva) als sie vom Baum der Erkenntnis (Etz HaDaat) im Paradies aßen.
In der Kabbalah haben die Segen eine noch ganz andere Bedeutung, denn dort geht es um Reinkarnationen (siehe Shaar HaGilgulim von Rabbi Yitzchak Luria). Zu dem Thema werde ich mehr auf meinem Kabbalah - Blog erläutern. Aber vorerst nur soviel, dass es zu dem Thema noch weitere Interpretationen gibt.
Warum sagen Juden einen weiteren Segen nach dem Essen / Trinken ? Reicht ein Segen vorher nicht aus ?
Rabbi Mordechai Machlis hatte hierzu einmal einen treffenden Kommentar. Vor dem Essen sind wir hungrig oder durstig und würden alles sagen, nur um uns zu sättigen. Nach dem Essen aber ist es viel schwerer einen Segen zu sagen, denn wer denkt schon an G - tt, wenn er alles hat ? Zu oft wird nur an G - tt gedacht, wenn etwas fehlt.
Wer relig. wird, den trifft oft der Schlag, wenn er die Vielzahl der Segen sieht. Zuerst ist es sicher nervig, das alles neu zu erlernen und zu behalten. Ist die Frucht nun vom Baum oder aus der Erde, ist es überhaupt eine Frucht und wie verändert sich der Segen, wenn Obst oder Gemüse weiterverarbeitet bzw. gekocht werden ?
Wer soll da noch durchsteigen ?
Wer jedoch erst einmal mit dem Lernen beginnt, der gewöhnt sich unglaublich schnell daran und vergißt nach einiger Zeit nicht mehr, die Segen zu sagen.
Eine Liste für jegliches Essen und dessen erforderliche Segen:
http://brochot.tripod.com/foods/index.htm
Chassidim im Holocaust
B"H
Zum Holocaust - Gedenktag am 27. Januar plane ich einige Artikel über die Chassidim im Holocaust.
Unter anderem beschreibe ich dabei die Lebensgeschichten des Klausenberger und des Belzer Rebben, das Überlebenden der Chassidut Bobov sowie weiterer chassidischer Dynastien.
Hier ein Artikel aus dem letzten Jahr:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/die-chassidische-reaktion-auf-den.html
Zum Holocaust - Gedenktag am 27. Januar plane ich einige Artikel über die Chassidim im Holocaust.
Unter anderem beschreibe ich dabei die Lebensgeschichten des Klausenberger und des Belzer Rebben, das Überlebenden der Chassidut Bobov sowie weiterer chassidischer Dynastien.
Hier ein Artikel aus dem letzten Jahr:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/die-chassidische-reaktion-auf-den.html
Labels:
Holocaust
Dienstag, Januar 08, 2008
Die Kopfbedeckung der Toldot Aharon Frauen
B"H
Die Toldot Aharon sind eine der extremsten chassidischen Gruppen in Mea Shearim.
Wer interessiert ist, der kann hier mehr ueber die Kopfbedeckung der Frauen der Toldot Aharon bzw. ihrer Abspaltung, den Avraham Yitzchak, erfahren:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/die-kopfbedeckung-der-toldot-aharon.html
Die Toldot Aharon sind eine der extremsten chassidischen Gruppen in Mea Shearim.
Wer interessiert ist, der kann hier mehr ueber die Kopfbedeckung der Frauen der Toldot Aharon bzw. ihrer Abspaltung, den Avraham Yitzchak, erfahren:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/die-kopfbedeckung-der-toldot-aharon.html
Labels:
Allgemein,
Frauen in der Orthodoxie
Montag, Januar 07, 2008
Spitznamen im Judentum
B"H
Nachdem ich schon zwei andere Themen aus dem Talmud Bava Metziah ausführte, will ich heute mit einem neuen Thema fortfahren.
In Bava Metziah 58b kommen Themen zum Ausdruck, deren viele von uns keine besondere Bedeutung beimessen, die aber dennoch wichtig sind. Insbesondere weil es um die Mitmenschen geht.
In der Gemara des Bava Metziah wird diskutiert, dass niemand seinen Mitmenschen öffentlich beschämen soll.
Eines der Zehn Gebote lautet: "Du sollst nicht töten".
Wenn wir dies hören, dann denken wir automatisch an Mord und Totschlag, aber "Du sollst nicht töten" bezieht sich genauso darauf, jemanden öffentlich zu töten. Sprich, ihn zu beschämen und dem öffentlichen Gespött preiszugeben. Metaphorisch wird der Betroffene genauso getötet, wie jemand, der real stirbt.
Ich möchte nicht auf alle Themen diesbezüglich auf einmal eingehen, sondern nach und nach, da vieles eingehender Erklärung bedarf.
Deswegen bringe ich soweit nur einen Punkt zur Sprache, der garantiert keinem auf den ersten Blick ins Auge fällt, wenn er irgendwo davon hört.
Unter anderem lehrt die Gemara niemandem bei einem Spitznamen zu nennen, da dadurch eine Person vor anderen beschämt wird.
Die Gemara fragt aber auch, was denn in dem Falle geschehe, wenn der Betroffene an einen speziellen Spitznamen gewohnt ist.
In der Situation beschäme man ihn doch gar nicht.
Doch die Talmudkommentatoren Rashi und der Maharsha sagen das Gegenteil. Auch nach einer Gewohnheit ist eine Person nach wie vor beschämt, wenn sie bei einem Spitznamen gerufen wird.
Viele Male meinen wir, dass eine Person alles andere als beschämt ist. Jemand macht eine dumme negative Bemerkung im Bekanntenkreis und stellt bewußt oder unbewußt jemand anderen bloß. Alle lachen und selbst der Betroffene mag in das Gelächter mit einstimmen. Sei ja eh nur ein Witz und nichts dabei.
Aber wissen wir mit Gewißheit zu sagen, was in dem Moment in der Person vorgeht, wenn jemand einen dummen Witz über ihn macht. Zwar mögen wir von demjenigen hören, dass es ihm nichts ausmache und das sei schon okay. Insgeheim aber wäre in solch einer Situation jeder verletzt. Zugeben will man es dennoch nur ungern und hofft lieber darauf, dass es alle schnell vergessen.
In der sechsten Klasse hatte ich einmal einen Lehrer, der für seine sarkastischen Bemerkungen recht bekannt an der Schule war. Einen Schüler hatte er besonders auf dem Kieker, denn derjenige war still und widersprach nie. Einmal nannte ihn der Lehrer wieder einmal bei einem Namen und fragte den Schüler, ob ihm das eigentlich etwas ausmache. Der Schüler sagte "Ja" und von dem Moment an suchte sich der Lehrer ein neues Opfer.
Grundsätzlich sollte jeder nur bei seinem Namen genannt werden, wobei bei einem Vortrag die Frage aufkam, ob denn ein Kosename auch unter die in der Gemara diskutierten Kategorie falle.
Beispiel: Yossi für Yosef oder Avi für Avraham.
Der Rabbi antwortete, dass diese Art der Kosenamen durchaus erlaubt sei, denn es gehe in Talmud Bava Metizah darum, Leute nicht in der Öffentlichkeit zu bloßzustellen.
Vorherige Themen aus Bava Metziah 58b:
http://hamantaschen.blogspot.com/2008/01/wieviel-kostet-das.html
http://hamantaschen.blogspot.com/2008/01/schau-woher-du-kommst.html
Nachdem ich schon zwei andere Themen aus dem Talmud Bava Metziah ausführte, will ich heute mit einem neuen Thema fortfahren.
In Bava Metziah 58b kommen Themen zum Ausdruck, deren viele von uns keine besondere Bedeutung beimessen, die aber dennoch wichtig sind. Insbesondere weil es um die Mitmenschen geht.
In der Gemara des Bava Metziah wird diskutiert, dass niemand seinen Mitmenschen öffentlich beschämen soll.
Eines der Zehn Gebote lautet: "Du sollst nicht töten".
Wenn wir dies hören, dann denken wir automatisch an Mord und Totschlag, aber "Du sollst nicht töten" bezieht sich genauso darauf, jemanden öffentlich zu töten. Sprich, ihn zu beschämen und dem öffentlichen Gespött preiszugeben. Metaphorisch wird der Betroffene genauso getötet, wie jemand, der real stirbt.
Ich möchte nicht auf alle Themen diesbezüglich auf einmal eingehen, sondern nach und nach, da vieles eingehender Erklärung bedarf.
Deswegen bringe ich soweit nur einen Punkt zur Sprache, der garantiert keinem auf den ersten Blick ins Auge fällt, wenn er irgendwo davon hört.
Unter anderem lehrt die Gemara niemandem bei einem Spitznamen zu nennen, da dadurch eine Person vor anderen beschämt wird.
Die Gemara fragt aber auch, was denn in dem Falle geschehe, wenn der Betroffene an einen speziellen Spitznamen gewohnt ist.
In der Situation beschäme man ihn doch gar nicht.
Doch die Talmudkommentatoren Rashi und der Maharsha sagen das Gegenteil. Auch nach einer Gewohnheit ist eine Person nach wie vor beschämt, wenn sie bei einem Spitznamen gerufen wird.
Viele Male meinen wir, dass eine Person alles andere als beschämt ist. Jemand macht eine dumme negative Bemerkung im Bekanntenkreis und stellt bewußt oder unbewußt jemand anderen bloß. Alle lachen und selbst der Betroffene mag in das Gelächter mit einstimmen. Sei ja eh nur ein Witz und nichts dabei.
Aber wissen wir mit Gewißheit zu sagen, was in dem Moment in der Person vorgeht, wenn jemand einen dummen Witz über ihn macht. Zwar mögen wir von demjenigen hören, dass es ihm nichts ausmache und das sei schon okay. Insgeheim aber wäre in solch einer Situation jeder verletzt. Zugeben will man es dennoch nur ungern und hofft lieber darauf, dass es alle schnell vergessen.
In der sechsten Klasse hatte ich einmal einen Lehrer, der für seine sarkastischen Bemerkungen recht bekannt an der Schule war. Einen Schüler hatte er besonders auf dem Kieker, denn derjenige war still und widersprach nie. Einmal nannte ihn der Lehrer wieder einmal bei einem Namen und fragte den Schüler, ob ihm das eigentlich etwas ausmache. Der Schüler sagte "Ja" und von dem Moment an suchte sich der Lehrer ein neues Opfer.
Grundsätzlich sollte jeder nur bei seinem Namen genannt werden, wobei bei einem Vortrag die Frage aufkam, ob denn ein Kosename auch unter die in der Gemara diskutierten Kategorie falle.
Beispiel: Yossi für Yosef oder Avi für Avraham.
Der Rabbi antwortete, dass diese Art der Kosenamen durchaus erlaubt sei, denn es gehe in Talmud Bava Metizah darum, Leute nicht in der Öffentlichkeit zu bloßzustellen.
Vorherige Themen aus Bava Metziah 58b:
http://hamantaschen.blogspot.com/2008/01/wieviel-kostet-das.html
http://hamantaschen.blogspot.com/2008/01/schau-woher-du-kommst.html
Der jüdische Monat Shevat (שבט)
B"H
In kurzer Zeit beginnt noch heute Abend der jüdische Monat Shevat. Morgen feiern wir dann den ganzen Tag über den Rosh Chodesh Shevat, den Beginn des Monat Shevat.
Kaum zu glauben, dass schon wieder Shevat ist. Normalerweise fällt der Monat auf einen etwas späteren Zeitpunkt, doch da in diesem Jahr im jüdischen Kalender ein Schaltjahr ansteht, kommt der Shevat eher an die Reihe, denn nach ihm folgen gleich zweimal die Monate Adar (Adar A und Adar B). Auch ist im Shevat ansonsten schon ein kleiner Hauch von Frühling zu verspüren, aber da wir eher liegen, fällt dieser Hauch derzeit weg und wir müssen uns mit dem kalten Winterwetter begnügen.
Auch bedeutet der Shevat für mich, wieder ein Jahr älter zu werden, wobei ich in meinem Alter nicht weiß, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Aber ich freue mich einmal, denn meine zwei Geburtstage (der jüdische sowie der weltliche) fallen jeweils auf einen Freitag. Kein Arbeitstag und dazu noch Schabbat.
Für all jene, die in diesen Tagen bzw. im Monat Shevat auch Geburtstag haben sollten: Im Judentum ist nicht unbedingt die Rolle des Geburtstages definiert. In der Thora ist der Tag nur einmal erwähnt, nämlich als Pharao Geburtstag hatte. Allerdings habe ich von vielen Rabbis gehört, dass jemand an seinem Geburtstag ganz besondere Rechte hat. An dem Tag kann er G - tt um etwas bitten und es heißt, das dieser Wunsch oft in Erfüllung geht.
Rosh Chodesh (der Monatsbeginn) ist das erste Gebot (Mitzwa) welches das jüdische Volk als eine Nation erhielt (siehe Parshat Bo und den Ramban). Ein neuer Monat bedeutet jedesmal auch die Zeit fuer eine persönliche Erneuerung. Shevat ist der 11. Monat im jüdischen Kalender und hat 30 Tage. An eben jenem 1. Shevat begann Moshe dem Volk Israel das Buch Deutoronomy (Sefer Devarim) vorzulesen. Sein letztes Vermächtnis bevor er im Monat Adar starb.
Dem Sefer Yetzirah (Book of Creation) zufolge symbolisiert jeder Monat einen hebräischen Buchstaben, eine Farbe, ein Organ, einen Stamm und ein Sternzeichen. Die Farbe des Shevat ist blau - grün, der Buchstabe ist Zaddik (צ), der Stamm ist Asher, das Organ ist der Magen und das Sternzeichen ist Wassermann. Dli (Eimer) auf Hebräisch. Außerdem symbolisiert Shevat die Sinne Essen und Geschmack. Es heisst, dass ein Gerechter ißt, um seine Seele zu befriedigen. Er ißt nur soviel wie er zum Überleben benoetigt.
Der Wassermann symbolisiert das Wasser, welches wiederum oftmals eine Metaphor fuer Thora ist. Ohne Wasser und Thora können wir nicht existieren. Somit ist Shevat auch ein neues Jahr zum Thoralernen.
Der Wassermann ist ein "air sign". Diejenigen, welche in diesem Sternzeichen geboren wurden, stehen für Rebellion, Veränderungen und spontane Entschlüsse. Sie befinden sich ständig auf der Identitätssuche, sind offen für neue Ideen und sind alles andere als angepasst. Sie hassen Eintönigkeit und sind sehr kommunikativ.
Im Monat Shevat starben sehr viele beruehmte Rabbiner, an deren Yahrzeiten (Sterbedaten) wir bis heute erinnern:
4 Shevat: Rabbi Israel Abuchatzeira, der Baba Sali, 1890 - 1984
5 Shevat: Rabbi Aryeh Yehudah Leib von Ger, 1847 - 1905, der Sefat Emet und Gruender der Chassidut Gur (Ger)
14 Shevat: Rabbi Aryeh Kaplan, 1935 - 1983
22 Shevat: Rabbi Menachem Mendel von Kotzk, 1787 - 1859
25 Shevat: Rabbi Israel Salanter
29: Rabbi Nosson Zvi Finkel, der Alter von Slobodka, 1849 - 1927
Des Weiteren starben führende Rebbes der chassidischen Gruppen Zanz und Lelov.
Halacha: Einfügen des Yaale ve Yavo - Gebetes in der Amidah und dem Birkat HaMazon.
Es ist Brauch, dass Frauen am Rosh Chodesh keine Hausarbeiten verrichten.
Chodesh Tov - Einen guten Monat an alle.
In kurzer Zeit beginnt noch heute Abend der jüdische Monat Shevat. Morgen feiern wir dann den ganzen Tag über den Rosh Chodesh Shevat, den Beginn des Monat Shevat.
Kaum zu glauben, dass schon wieder Shevat ist. Normalerweise fällt der Monat auf einen etwas späteren Zeitpunkt, doch da in diesem Jahr im jüdischen Kalender ein Schaltjahr ansteht, kommt der Shevat eher an die Reihe, denn nach ihm folgen gleich zweimal die Monate Adar (Adar A und Adar B). Auch ist im Shevat ansonsten schon ein kleiner Hauch von Frühling zu verspüren, aber da wir eher liegen, fällt dieser Hauch derzeit weg und wir müssen uns mit dem kalten Winterwetter begnügen.
Auch bedeutet der Shevat für mich, wieder ein Jahr älter zu werden, wobei ich in meinem Alter nicht weiß, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Aber ich freue mich einmal, denn meine zwei Geburtstage (der jüdische sowie der weltliche) fallen jeweils auf einen Freitag. Kein Arbeitstag und dazu noch Schabbat.
Für all jene, die in diesen Tagen bzw. im Monat Shevat auch Geburtstag haben sollten: Im Judentum ist nicht unbedingt die Rolle des Geburtstages definiert. In der Thora ist der Tag nur einmal erwähnt, nämlich als Pharao Geburtstag hatte. Allerdings habe ich von vielen Rabbis gehört, dass jemand an seinem Geburtstag ganz besondere Rechte hat. An dem Tag kann er G - tt um etwas bitten und es heißt, das dieser Wunsch oft in Erfüllung geht.
Rosh Chodesh (der Monatsbeginn) ist das erste Gebot (Mitzwa) welches das jüdische Volk als eine Nation erhielt (siehe Parshat Bo und den Ramban). Ein neuer Monat bedeutet jedesmal auch die Zeit fuer eine persönliche Erneuerung. Shevat ist der 11. Monat im jüdischen Kalender und hat 30 Tage. An eben jenem 1. Shevat begann Moshe dem Volk Israel das Buch Deutoronomy (Sefer Devarim) vorzulesen. Sein letztes Vermächtnis bevor er im Monat Adar starb.
Dem Sefer Yetzirah (Book of Creation) zufolge symbolisiert jeder Monat einen hebräischen Buchstaben, eine Farbe, ein Organ, einen Stamm und ein Sternzeichen. Die Farbe des Shevat ist blau - grün, der Buchstabe ist Zaddik (צ), der Stamm ist Asher, das Organ ist der Magen und das Sternzeichen ist Wassermann. Dli (Eimer) auf Hebräisch. Außerdem symbolisiert Shevat die Sinne Essen und Geschmack. Es heisst, dass ein Gerechter ißt, um seine Seele zu befriedigen. Er ißt nur soviel wie er zum Überleben benoetigt.
Der Wassermann symbolisiert das Wasser, welches wiederum oftmals eine Metaphor fuer Thora ist. Ohne Wasser und Thora können wir nicht existieren. Somit ist Shevat auch ein neues Jahr zum Thoralernen.
Der Wassermann ist ein "air sign". Diejenigen, welche in diesem Sternzeichen geboren wurden, stehen für Rebellion, Veränderungen und spontane Entschlüsse. Sie befinden sich ständig auf der Identitätssuche, sind offen für neue Ideen und sind alles andere als angepasst. Sie hassen Eintönigkeit und sind sehr kommunikativ.
Im Monat Shevat starben sehr viele beruehmte Rabbiner, an deren Yahrzeiten (Sterbedaten) wir bis heute erinnern:
4 Shevat: Rabbi Israel Abuchatzeira, der Baba Sali, 1890 - 1984
5 Shevat: Rabbi Aryeh Yehudah Leib von Ger, 1847 - 1905, der Sefat Emet und Gruender der Chassidut Gur (Ger)
14 Shevat: Rabbi Aryeh Kaplan, 1935 - 1983
22 Shevat: Rabbi Menachem Mendel von Kotzk, 1787 - 1859
25 Shevat: Rabbi Israel Salanter
29: Rabbi Nosson Zvi Finkel, der Alter von Slobodka, 1849 - 1927
Des Weiteren starben führende Rebbes der chassidischen Gruppen Zanz und Lelov.
Halacha: Einfügen des Yaale ve Yavo - Gebetes in der Amidah und dem Birkat HaMazon.
Es ist Brauch, dass Frauen am Rosh Chodesh keine Hausarbeiten verrichten.
Chodesh Tov - Einen guten Monat an alle.
Labels:
Feiertage
Sonntag, Januar 06, 2008
Kinderhochzeiten
B"H
Für Interessierte an der haredischen (ultra - orthod.) Gesellschaft und den internen Heiratsmethoden:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/kinderhochzeiten.html
Für Interessierte an der haredischen (ultra - orthod.) Gesellschaft und den internen Heiratsmethoden:
http://chassidicstories.blogspot.com/2008/01/kinderhochzeiten.html
Schabbes Koidesch
B"H
Schabbes Koidesch = Yiddisch: Heiliger Schabbat
Unsere zwei großen Tisch - Favoriten, die chassidischen Gruppen Toldot Aharon sowie deren Abspaltung Toldot Avraham Yitzchak, werden erst in drei Wochen ihren nächsten chassidischen Tisch geben. Die Rebben der zwei Gruppen befinden sich im Ausland.
Mein spezielles Gebiet, über eine der extremsten chassidischen Gruppen, die Toldot Aharon, zu berichten, muß daher noch etwas warten.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
http://hamantaschen.blogspot.com/2007/09/die-koenigin-der-nacht.html
Einerseits gibt uns die "freie" Zeit natürlich Gelegenheiten, uns auch um anderen kleiner chassidische Gruppen zu kümmern, denn wer kennt schon außerhalb der chassidischen Welt Gruppen wie die Slonim, Karlin - Stolin oder Kretchnif ?
Andererseits aber vermissen meine Freundin und ich die Toldot Aharon ungemein. Bei ihnen haben wir die nettesten Frauen kennen gelernt und schon mit tollen Leuten gesprochen. Zugegeben, es braucht unendlich viel Zeit und Geduld, solcherlei Kontakte aufzubauen. Die Mitglieder der Toldot Aharon, insbesondere die Frauen, geben sich nur mit Ihresgleichen ab und Freundschaften nach außen sind fast unmöglich. Weiterhin dauert es sehr lange, bis einiges an Vertrauen aufgebaut wird und bis zu dem Zeitpunkt, an dem man wirklich über intimere Themen redet. Ein israel. Journalist, der vor Jahren ein Buch über die Chassidim in Mea Shearim herausbrachte, benötigte volle vier Jahre, um interne Kontakte zu den dortigen Chassidim herzustellen.
Allerdings muß ich offen zugeben, dass ich soweit nicht alles veröffentlicht habe, was wir real erlebten. Erstens bin ich noch nicht zu allem gekommen und zweitens bin ich der Ansicht, dass nicht alles in die Öffentlichkeit gehört. Auch die Chassidim haben ein Anrecht auf Privatleben und es geht mir bei dem Thema nicht um schnelle Schlagzeilen.
Freitag Abend dann waren wir erneut gezwungen, einen Ersatz für unsere zwei Tisch - Favoriten aufzutreiben und nachdem bei der Chassidut Dushinsky extreme Ruhe herrschte, gingen wir erst gar nicht in deren Synagoge hinein. Stattdessen gingen wir die Yoel Street hinauf zur Chassidut Kretchnif.
Der Jerusalemer Krechtnif Rebbe ist nicht der einzige der Chassidut. Weitere Rebben hat Kretchnif in Haifa, Rehovot oder Williamsburgh (New York).
Wie ich zuvor erwähnte, sind die Kretchnif Frauen recht distanziert gegenüber auswärtigen Besuchern. Mit "auswärtig" meine ich hierbei Leute außerhalb Mea Shearims.
Mit der Zeit gibt sich dieses Verhalten jedoch. Vor allem dann, wenn man ihr Yiddisch versteht und Fragen zur Chassidut stellt. Auch die Rebbitzen taut auf und Freitag Abend bekamen wir sogar Kuchen hingestellt.
Bei anderen Gruppen ist es etwas anders. Besonders mit den Toldot Aharon kam ich sehr schnell in Kontakt. Ich möchte fast sagen, dass wenn sie einmal sehen, wer man ist, sie schnell auf einen zugehen. Dazu gehören Yiddisch bzw. Hebräischkenntnisse. Dass jemand Jude sein sollte, versteht sich von selbst. Des Weiteren werden orthodoxe Juden und diverse Kenntnisse in der Religion erwartet. Mit "Kennissen" meine ich jetzt keinesfalls, dass jemand einem Test unterzogen wird. Vielmehr haben die Chassidim ihre eigene Sprache sowie Slogans und diese Sprache sollte man beherrschen. Wer auf haredischen Yeshivot (relig. Schulen) war, hat diesbezüglich keinerlei Probleme. Nicht erwartet wird dagegen, dass man mit ihren Dogmen und Ansichten übereinstimmt.
Da in Mea Shearim derzeit kaum chassidische Tisch stattfinden, suchten auch die Mitglieder der Toldot Aharon nach Auswegen. Und so kam es, dass wir gestern eine derer Frauen mit ihren zwei kleinen Töchtern bei Kretchnif antrafen. Unten bei den Männern waren, wie üblich, auch Mitglieder von den Slonim, Satmar, Toldot Aharon oder den Shomrei Emunim anzutreffen. Der Kretchnifer Rebbe war bester Laune und dirigierte euphorisch die Chassidim. Singen ist erwünscht und der Rebbe achtet darauf, dass alle mächtig engagiert bei der Sache sind. Er ist überaus freundlich und jeder ist willkommen. Er macht keinen Unterschied zwischen einem Satmarer Chassid oder jemandem aus seiner eigenen Chassidut. Ein jeder Tischteilnehmer bekommt Essen ausgeteilt, wobei es zum Ende hin Früchte und Kuchen gibt.
Dass, was mir am besten am Kretchnifer Tisch gefällt ist, wenn der Rebbe alleine tanzt. Dies tut er gewöhnlich zweimal und es ist jedesmal toll, dies mit anzusehen. Dazwischen tanzen die Chassidim in einem großen Kreis durch den Raum und ganz zum Schluß mischt auch der Rebbe im Kreis mit.
Wer einen bewegenden enthusiastischen chassidischen Tisch sucht, der kommt bei Kretchnif richtig. Ebenfalls von Vorteil ist, dass es sich um eine kleine Chassidut handelt und der Raum nicht mit mehreren Hundert Chassidim überfüllt ist, wie bei Belz, Toldot Aharon, den Slonim oder Toldot Avraham Yitzchak. Freitag Abend, zum Beispiel, waren nur ca. 60 Chassidim anwesend.
Gegen 2.00 Uhr nachts ging der Tisch zuende und der Rebbe verabschiedete sich. Als wir draußen ankamen, stutzten die Chassidim und es kam fast zu einem Eklat. Wir wurden Zeuge einer etwas obskuren Szene und ich weiß bisher nicht so recht, wie ich das Ereignis deuten soll.
Als wir nach wenigen Metern in die Yoel Street kamen, stand dort ein weißes Auto mit blauer Aufschrift: "Schmira Ke'Halacha - Wächter laut Halacha". Der Wagen war einem Polizeiwagen ähnlich, doch sollte es sich hierbei laut der Aufschrift um etwas Religiöses handeln. Warum aber fährt eine angeblich relig. Wache am Schabbat mit einem Auto durch Mea Searim ? Die Chassidim jedenfalls stürzten auf den Wagen zu und dieser fuhr sogleich an und einige Meter außer Reichweite. Ich konnte nicht erkennen, wer am Steuer saß.
Anscheinend aber war ich nicht die Einzige, die sich keinen Reim auf das unbekannte Farhrzeug machen konnte, denn die Chassidim reagierten verärgert.
Sollte am kommenden Freitag Abend die Chassidut Dushinsky keinen Tisch veranstalten, dann werden wir wieder bei Kretchnif landen und hoffentlich einige gute Gespräche mit den Frauen führen. Denn diese scheinen so langsam aufzutauen.
Schabbes Koidesch = Yiddisch: Heiliger Schabbat
Unsere zwei großen Tisch - Favoriten, die chassidischen Gruppen Toldot Aharon sowie deren Abspaltung Toldot Avraham Yitzchak, werden erst in drei Wochen ihren nächsten chassidischen Tisch geben. Die Rebben der zwei Gruppen befinden sich im Ausland.
Mein spezielles Gebiet, über eine der extremsten chassidischen Gruppen, die Toldot Aharon, zu berichten, muß daher noch etwas warten.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
http://hamantaschen.blogspot.com/2007/09/die-koenigin-der-nacht.html
Einerseits gibt uns die "freie" Zeit natürlich Gelegenheiten, uns auch um anderen kleiner chassidische Gruppen zu kümmern, denn wer kennt schon außerhalb der chassidischen Welt Gruppen wie die Slonim, Karlin - Stolin oder Kretchnif ?
Andererseits aber vermissen meine Freundin und ich die Toldot Aharon ungemein. Bei ihnen haben wir die nettesten Frauen kennen gelernt und schon mit tollen Leuten gesprochen. Zugegeben, es braucht unendlich viel Zeit und Geduld, solcherlei Kontakte aufzubauen. Die Mitglieder der Toldot Aharon, insbesondere die Frauen, geben sich nur mit Ihresgleichen ab und Freundschaften nach außen sind fast unmöglich. Weiterhin dauert es sehr lange, bis einiges an Vertrauen aufgebaut wird und bis zu dem Zeitpunkt, an dem man wirklich über intimere Themen redet. Ein israel. Journalist, der vor Jahren ein Buch über die Chassidim in Mea Shearim herausbrachte, benötigte volle vier Jahre, um interne Kontakte zu den dortigen Chassidim herzustellen.
Allerdings muß ich offen zugeben, dass ich soweit nicht alles veröffentlicht habe, was wir real erlebten. Erstens bin ich noch nicht zu allem gekommen und zweitens bin ich der Ansicht, dass nicht alles in die Öffentlichkeit gehört. Auch die Chassidim haben ein Anrecht auf Privatleben und es geht mir bei dem Thema nicht um schnelle Schlagzeilen.
Freitag Abend dann waren wir erneut gezwungen, einen Ersatz für unsere zwei Tisch - Favoriten aufzutreiben und nachdem bei der Chassidut Dushinsky extreme Ruhe herrschte, gingen wir erst gar nicht in deren Synagoge hinein. Stattdessen gingen wir die Yoel Street hinauf zur Chassidut Kretchnif.
Der Jerusalemer Krechtnif Rebbe ist nicht der einzige der Chassidut. Weitere Rebben hat Kretchnif in Haifa, Rehovot oder Williamsburgh (New York).
Wie ich zuvor erwähnte, sind die Kretchnif Frauen recht distanziert gegenüber auswärtigen Besuchern. Mit "auswärtig" meine ich hierbei Leute außerhalb Mea Shearims.
Mit der Zeit gibt sich dieses Verhalten jedoch. Vor allem dann, wenn man ihr Yiddisch versteht und Fragen zur Chassidut stellt. Auch die Rebbitzen taut auf und Freitag Abend bekamen wir sogar Kuchen hingestellt.
Bei anderen Gruppen ist es etwas anders. Besonders mit den Toldot Aharon kam ich sehr schnell in Kontakt. Ich möchte fast sagen, dass wenn sie einmal sehen, wer man ist, sie schnell auf einen zugehen. Dazu gehören Yiddisch bzw. Hebräischkenntnisse. Dass jemand Jude sein sollte, versteht sich von selbst. Des Weiteren werden orthodoxe Juden und diverse Kenntnisse in der Religion erwartet. Mit "Kennissen" meine ich jetzt keinesfalls, dass jemand einem Test unterzogen wird. Vielmehr haben die Chassidim ihre eigene Sprache sowie Slogans und diese Sprache sollte man beherrschen. Wer auf haredischen Yeshivot (relig. Schulen) war, hat diesbezüglich keinerlei Probleme. Nicht erwartet wird dagegen, dass man mit ihren Dogmen und Ansichten übereinstimmt.
Da in Mea Shearim derzeit kaum chassidische Tisch stattfinden, suchten auch die Mitglieder der Toldot Aharon nach Auswegen. Und so kam es, dass wir gestern eine derer Frauen mit ihren zwei kleinen Töchtern bei Kretchnif antrafen. Unten bei den Männern waren, wie üblich, auch Mitglieder von den Slonim, Satmar, Toldot Aharon oder den Shomrei Emunim anzutreffen. Der Kretchnifer Rebbe war bester Laune und dirigierte euphorisch die Chassidim. Singen ist erwünscht und der Rebbe achtet darauf, dass alle mächtig engagiert bei der Sache sind. Er ist überaus freundlich und jeder ist willkommen. Er macht keinen Unterschied zwischen einem Satmarer Chassid oder jemandem aus seiner eigenen Chassidut. Ein jeder Tischteilnehmer bekommt Essen ausgeteilt, wobei es zum Ende hin Früchte und Kuchen gibt.
Dass, was mir am besten am Kretchnifer Tisch gefällt ist, wenn der Rebbe alleine tanzt. Dies tut er gewöhnlich zweimal und es ist jedesmal toll, dies mit anzusehen. Dazwischen tanzen die Chassidim in einem großen Kreis durch den Raum und ganz zum Schluß mischt auch der Rebbe im Kreis mit.
Wer einen bewegenden enthusiastischen chassidischen Tisch sucht, der kommt bei Kretchnif richtig. Ebenfalls von Vorteil ist, dass es sich um eine kleine Chassidut handelt und der Raum nicht mit mehreren Hundert Chassidim überfüllt ist, wie bei Belz, Toldot Aharon, den Slonim oder Toldot Avraham Yitzchak. Freitag Abend, zum Beispiel, waren nur ca. 60 Chassidim anwesend.
Gegen 2.00 Uhr nachts ging der Tisch zuende und der Rebbe verabschiedete sich. Als wir draußen ankamen, stutzten die Chassidim und es kam fast zu einem Eklat. Wir wurden Zeuge einer etwas obskuren Szene und ich weiß bisher nicht so recht, wie ich das Ereignis deuten soll.
Als wir nach wenigen Metern in die Yoel Street kamen, stand dort ein weißes Auto mit blauer Aufschrift: "Schmira Ke'Halacha - Wächter laut Halacha". Der Wagen war einem Polizeiwagen ähnlich, doch sollte es sich hierbei laut der Aufschrift um etwas Religiöses handeln. Warum aber fährt eine angeblich relig. Wache am Schabbat mit einem Auto durch Mea Searim ? Die Chassidim jedenfalls stürzten auf den Wagen zu und dieser fuhr sogleich an und einige Meter außer Reichweite. Ich konnte nicht erkennen, wer am Steuer saß.
Anscheinend aber war ich nicht die Einzige, die sich keinen Reim auf das unbekannte Farhrzeug machen konnte, denn die Chassidim reagierten verärgert.
Sollte am kommenden Freitag Abend die Chassidut Dushinsky keinen Tisch veranstalten, dann werden wir wieder bei Kretchnif landen und hoffentlich einige gute Gespräche mit den Frauen führen. Denn diese scheinen so langsam aufzutauen.
Labels:
Chassidischer Tisch,
Chassidut,
Chassidut Kretchnif,
Jerusalem
Samstag, Januar 05, 2008
Der Rebbe hutt gesugt
B"H
Einen ausführlichen Bericht zu unserem Besuch eines weiteren chassidischen Tisches schreibe ich Morgen. Vorab ein besonderes Teaching des Rebben der Kretchnifer Chassidim in Jerusalem.
Am gestrigen Erev Schabbat waren die chassidischen Tische äußerst rar. Nur die Gruppen Belz, die Slonim sowie Kretchnif veranstalteten einen Tisch mit ihren Rebben.
Wir nahmen bei Kretchnif teil und bereuten es ganz gewiss nicht. Im Gegenteil.
Der Rebbe der Jerusalemer Krechtnifer Chassidim, Rabbi Rosenbaum, hat die Angewohnheit, zwei Derashot (Thora - Teachings) während seines Tisches zu halten. Seine dritte Rede ist jedesmal privater Natur, wobei er gewöhnlich auch Treffen mit weiteren chassidischen Rebben erwähnt.
Obwohl er verhältnismässig leise spricht, konnte ich oben auf der Frauenempore doch einige Brocken verstehen. Mein Yiddish verbessert sich allmählich. Der Rebbe begann zwar leise zu sprechen und seine Chassidim versammeln sich aus dem Grund jedesmal ganz nahe um ihn herum; nichtsdestotrotz redete er sich so in Rage und war dermassen in seine Rede vertieft, dass er immer lauter wurde. Zu unserem Glück, denn wir konnten ihn gut hören.
In seiner ersten Derasha erläuterte der Rebbe das Thema "Gebet - Tefillah".
Die Israeliten seien, unter anderem, aus Ägypten geführt wurden, weil sie niemals ihren Sinn fuer ein inniges Gebet verloren.
In der heutigen Zeit sei es leider so, dass viele auf die Uhr schauen und sehen, dass es Zeit zum Beten ist. Ein Gebet darf nie ohne gründliche Vorbereitung (Mechina) vollzogen werden. Ein jeder sollte sich innerlich vorbereiten und seinen Kopf vorher von äusseren Einflüssen freibekommen.
Ein Gebet muss jedesmal neu mit äußerster Konzentration gesagt werden, denn nur so kann es stattfinden. Anhand eines Gebetes kommt man G - tt näher (Devekut) und dies sollte nicht nur gesagt werden, weil es gerade einmal Zeit dafür ist.
Der Kretchnifer Rebbe bei einem seiner Tisch am vergangenen Purim:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2985693741374990669
Einen ausführlichen Bericht zu unserem Besuch eines weiteren chassidischen Tisches schreibe ich Morgen. Vorab ein besonderes Teaching des Rebben der Kretchnifer Chassidim in Jerusalem.
Am gestrigen Erev Schabbat waren die chassidischen Tische äußerst rar. Nur die Gruppen Belz, die Slonim sowie Kretchnif veranstalteten einen Tisch mit ihren Rebben.
Wir nahmen bei Kretchnif teil und bereuten es ganz gewiss nicht. Im Gegenteil.
Der Rebbe der Jerusalemer Krechtnifer Chassidim, Rabbi Rosenbaum, hat die Angewohnheit, zwei Derashot (Thora - Teachings) während seines Tisches zu halten. Seine dritte Rede ist jedesmal privater Natur, wobei er gewöhnlich auch Treffen mit weiteren chassidischen Rebben erwähnt.
Obwohl er verhältnismässig leise spricht, konnte ich oben auf der Frauenempore doch einige Brocken verstehen. Mein Yiddish verbessert sich allmählich. Der Rebbe begann zwar leise zu sprechen und seine Chassidim versammeln sich aus dem Grund jedesmal ganz nahe um ihn herum; nichtsdestotrotz redete er sich so in Rage und war dermassen in seine Rede vertieft, dass er immer lauter wurde. Zu unserem Glück, denn wir konnten ihn gut hören.
In seiner ersten Derasha erläuterte der Rebbe das Thema "Gebet - Tefillah".
Die Israeliten seien, unter anderem, aus Ägypten geführt wurden, weil sie niemals ihren Sinn fuer ein inniges Gebet verloren.
In der heutigen Zeit sei es leider so, dass viele auf die Uhr schauen und sehen, dass es Zeit zum Beten ist. Ein Gebet darf nie ohne gründliche Vorbereitung (Mechina) vollzogen werden. Ein jeder sollte sich innerlich vorbereiten und seinen Kopf vorher von äusseren Einflüssen freibekommen.
Ein Gebet muss jedesmal neu mit äußerster Konzentration gesagt werden, denn nur so kann es stattfinden. Anhand eines Gebetes kommt man G - tt näher (Devekut) und dies sollte nicht nur gesagt werden, weil es gerade einmal Zeit dafür ist.
Der Kretchnifer Rebbe bei einem seiner Tisch am vergangenen Purim:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2985693741374990669
Labels:
Chassidut
Freitag, Januar 04, 2008
Unterwegs
B"H
Keinerlei bestimmte Pläne.
So schaut es für meine Freundin und mich heute Abend aus. Nur eines ist sicher; wir werden zum Schabbat - Dinner von Rabbi Mordechai Machlis gehen und dann schauen wir einmal weiter. Sicher führt uns unser erster Gang zur Chassidut Dushinsky und wir werden sehen, ob dort ein chassidischer Tisch stattfindet.
Die Toldot Avraham Yitzchak scheiden für gewisse Zeit aus, denn der Rebbe reist mit Anhang in der Weltgeschichte herum. Das Gleiche hörten wir vom Rebben der Toldot Aharon, was uns jedoch nicht abhalten wir, auszuspionieren, ob diese Behauptung wirklich der Wirklichkeit entspricht. Nebenbei wollen wir aber die kleineren chassidischen Gruppen nicht außer Acht lassen und werden auch dort vorbeischauen. Nächste Woche ist der Beginn des jüdischen Monat Schevat (Rosh Chodesh Shevat) und vielleicht tut sich von daher etwas bei Karlin - Stolin.
Viele chassidische Rebben nutzen die Monate Januar / Februar regelmäßig zum Reisen in der Hoffnung, Geldspenden für ihre chassidische Gruppe einzutreiben. Insbesondere die kleineren Gruppen hängen von solcherlei Spenden ab (wie z.B. die Toldot Avraham Yitzchak).
Wen es interessiert, der kann hier ein Interview mit einer jungen Frau der extremen Toldot Aharon - Gruppe lesen. Ihre Aussagen geben dem Aussenstehenden einige Einblicke in deren Gruppe samt ihren recht extremen Vorstellungen. Anmerken sollte ich dennoch, dass die Aussage der jungen Frau nicht immer die Regel ist. Auch bei einer Gruppe wie den Toldot Aharon haben sich schon einige Frauen zu kleinen Rebellinnen entwickelt. Jedoch nicht mit der Hauruck - Methode, sondern alles geht seinen ganz langsamen Gang.
Sobald der Rebbe der Toldot Aharon wieder anwesend ist und einen chassidischen Tisch gibt, berichte ich mehr über die Gruppe.
Shabbat Shalom
Chassidischer Tisch der Chassidut Belz in Jerusalem. Einige Chassidim stehen auf dem Tisch, da sie Essen verteilen.

Chassid der Toldot Aharon - Gruppe in der Hauptstrasse Mea Shearims / Jerusalem

Keinerlei bestimmte Pläne.
So schaut es für meine Freundin und mich heute Abend aus. Nur eines ist sicher; wir werden zum Schabbat - Dinner von Rabbi Mordechai Machlis gehen und dann schauen wir einmal weiter. Sicher führt uns unser erster Gang zur Chassidut Dushinsky und wir werden sehen, ob dort ein chassidischer Tisch stattfindet.
Die Toldot Avraham Yitzchak scheiden für gewisse Zeit aus, denn der Rebbe reist mit Anhang in der Weltgeschichte herum. Das Gleiche hörten wir vom Rebben der Toldot Aharon, was uns jedoch nicht abhalten wir, auszuspionieren, ob diese Behauptung wirklich der Wirklichkeit entspricht. Nebenbei wollen wir aber die kleineren chassidischen Gruppen nicht außer Acht lassen und werden auch dort vorbeischauen. Nächste Woche ist der Beginn des jüdischen Monat Schevat (Rosh Chodesh Shevat) und vielleicht tut sich von daher etwas bei Karlin - Stolin.
Viele chassidische Rebben nutzen die Monate Januar / Februar regelmäßig zum Reisen in der Hoffnung, Geldspenden für ihre chassidische Gruppe einzutreiben. Insbesondere die kleineren Gruppen hängen von solcherlei Spenden ab (wie z.B. die Toldot Avraham Yitzchak).
Wen es interessiert, der kann hier ein Interview mit einer jungen Frau der extremen Toldot Aharon - Gruppe lesen. Ihre Aussagen geben dem Aussenstehenden einige Einblicke in deren Gruppe samt ihren recht extremen Vorstellungen. Anmerken sollte ich dennoch, dass die Aussage der jungen Frau nicht immer die Regel ist. Auch bei einer Gruppe wie den Toldot Aharon haben sich schon einige Frauen zu kleinen Rebellinnen entwickelt. Jedoch nicht mit der Hauruck - Methode, sondern alles geht seinen ganz langsamen Gang.
Sobald der Rebbe der Toldot Aharon wieder anwesend ist und einen chassidischen Tisch gibt, berichte ich mehr über die Gruppe.
Shabbat Shalom
Chassidischer Tisch der Chassidut Belz in Jerusalem. Einige Chassidim stehen auf dem Tisch, da sie Essen verteilen.

Chassid der Toldot Aharon - Gruppe in der Hauptstrasse Mea Shearims / Jerusalem

Donnerstag, Januar 03, 2008
"Schau, woher Du kommst…"
B"H
In einem vorherigen Artikel führte ich eine Mischna (mündl. Gesetzesüberlieferung G - ttes an Moshe am Berg Sinai) aus dem Talmud Traktat Bava Metziah 58b genauer aus. Es ging darum, dass niemand nach dem Preis einer Ware fragen sollte, wenn er dies nur aus Langeweile tut und an keinem ernsthaften Kauf interessiert ist.
Dieselbe Mischna fährt fort mit einem weiteren Verbot, dessen sich so mancher auch nicht bewußt sein mag.
Die Mischna in Bava Metziah 58b:
"Niemand sollte jemandem sagen: Erinnerst Du Dich nicht, was Deine Vorfahren getan haben ?
Dieses Gesetz bezieht die Mischna im weiteren Verlauf auf Konvertiten zum Judentum.
Die Gemara (rabbinische Diskussionen) in Bava Metziah 58b erläutert die obige Mischna:
Wenn jemand von Konvertiten zum Judentum abstammt, dann darf er nicht daran erinnert werden, wer seine Vorfahren waren oder was diese getan haben. Wenn solch ein Betroffener Thora lernen will, dann darf sich nicht über ihn sowie seine Vorfahren lustig gemacht werden.
Dieses Gesetz wird bis heute sehr ernst genommen und wird in religiösen Kreisen genauso auf geborene Juden, welche erst im späteren Verlauf ihres Lebens religiös geworden sind, angewandt.
Niemand sollte sich über ernsthafte Konvertiten, die laut der Halacha zum Judentum konvertiert sind lustig machen oder sie verspotten. Halachisch ist es verboten, solche Leute an ihr Vorleben bzw. ihre nichtjüdischen Vorfahren zu erinnern. Immer sollte man davon Abstand nehmen zu sagen: "Ah, Du bist ja eh nur konvertiert".
Bezüglich der Konvertiten ist diese reale Anwendung der Halacha leider heutzutage immer weniger der Fall. Entweder ist den Mitmenschen diese Halacha gänzlich unbekannt oder es interessiert sie einfach nicht. In Israel ist es in relig. Kreise leider oft so, Konvertiten oder die sogenannten Baalei Teshuva (geborene Juden, die später religiös wurden) als minderwertig zu betrachten. Dies geschieht vielseits bei Schidduchim (der Ehepartnersuche) oder bei der Suche nach relig. Schulen bzw. Yeshivot. Auch kommt es nicht selten vor, dass die Nachbarn lästern.
Manchmal bilden die Nationalrelig. nicht gerade die Regel und alle schieben dieses halachawidrige Verhalten immer nur den Haredim (Ultra - Orthod.) in die Schuhe. Dennoch, auch die Nationalreligiösen haben ihre Einschränkungen, wen sie akzeptieren wollen. Das Gleiche betrifft geborene Juden, die erst später im Leben religiös geworden sind. Auch sie haben mit entsprechenden Vorurteilen zu kämpfen.
Nicht jeder in relig. Kreisen missachtet diese Halacha und nicht alle hetzen nun gegen Konvertiten oder Baalei Teshuva. Anzumerken aber bleibt, dass es eben doch viele tun, wenn manchmal auch nur mit verbalen Hinweisen. Was zu früherer Zeit als eine große Tat angesehen wurde (alles aufzugeben und sein Leben neu und relig. zu gestalten), wird jetzt oft mit Mißtrauen begegnet. Anscheinend auch, weil viele geborene Religiöse negative Erfahrungen mit Konvertiten oder Baalei Teshuva machten. Die Presse tut da oftmals ihr Übriges, wenn sie ausgerechnet die "falschen" Konvertiten in die Schlagzeilen hievt und nicht jene, die sich sehr wohl ein jüdisch relig. Leben aufbauen wollen. Ebenso mit den Baalei Teshuva, von denen vielfach behauptet wird, sie seien vorher kriminell (Drogen etc.) gewesen.
Im Talmud ist diese Halacha nur kurz erwähnt, dennoch halte ich sie für bedeutsam. Unter anderem auch, weil immer wieder diverse Bemerkungen kommen, ohne das es derjenige vielleicht beabsichtigte.
Ein Yeshivalehrer von mir war ein Baal Teshuva und zuvor hatte er ein recht wildes sekuläres Leben geführt. Eine Mitschülerin machte diesbezüglich einmal eine spitze Bemerkung auf die er recht harsch reagierte. Man solle niemandem, der jetzt eindeutig relig. lebe vorwerfen, welche Fehler er in den vorherigen Jahren begangen habe. Wer sei denn derjenige, der soetwas sagt. Weiß er vielleicht besser als G - tt, was in dem Menschen heute vorgehe ?
In einem vorherigen Artikel führte ich eine Mischna (mündl. Gesetzesüberlieferung G - ttes an Moshe am Berg Sinai) aus dem Talmud Traktat Bava Metziah 58b genauer aus. Es ging darum, dass niemand nach dem Preis einer Ware fragen sollte, wenn er dies nur aus Langeweile tut und an keinem ernsthaften Kauf interessiert ist.
Dieselbe Mischna fährt fort mit einem weiteren Verbot, dessen sich so mancher auch nicht bewußt sein mag.
Die Mischna in Bava Metziah 58b:
"Niemand sollte jemandem sagen: Erinnerst Du Dich nicht, was Deine Vorfahren getan haben ?
Dieses Gesetz bezieht die Mischna im weiteren Verlauf auf Konvertiten zum Judentum.
Die Gemara (rabbinische Diskussionen) in Bava Metziah 58b erläutert die obige Mischna:
Wenn jemand von Konvertiten zum Judentum abstammt, dann darf er nicht daran erinnert werden, wer seine Vorfahren waren oder was diese getan haben. Wenn solch ein Betroffener Thora lernen will, dann darf sich nicht über ihn sowie seine Vorfahren lustig gemacht werden.
Dieses Gesetz wird bis heute sehr ernst genommen und wird in religiösen Kreisen genauso auf geborene Juden, welche erst im späteren Verlauf ihres Lebens religiös geworden sind, angewandt.
Niemand sollte sich über ernsthafte Konvertiten, die laut der Halacha zum Judentum konvertiert sind lustig machen oder sie verspotten. Halachisch ist es verboten, solche Leute an ihr Vorleben bzw. ihre nichtjüdischen Vorfahren zu erinnern. Immer sollte man davon Abstand nehmen zu sagen: "Ah, Du bist ja eh nur konvertiert".
Bezüglich der Konvertiten ist diese reale Anwendung der Halacha leider heutzutage immer weniger der Fall. Entweder ist den Mitmenschen diese Halacha gänzlich unbekannt oder es interessiert sie einfach nicht. In Israel ist es in relig. Kreise leider oft so, Konvertiten oder die sogenannten Baalei Teshuva (geborene Juden, die später religiös wurden) als minderwertig zu betrachten. Dies geschieht vielseits bei Schidduchim (der Ehepartnersuche) oder bei der Suche nach relig. Schulen bzw. Yeshivot. Auch kommt es nicht selten vor, dass die Nachbarn lästern.
Manchmal bilden die Nationalrelig. nicht gerade die Regel und alle schieben dieses halachawidrige Verhalten immer nur den Haredim (Ultra - Orthod.) in die Schuhe. Dennoch, auch die Nationalreligiösen haben ihre Einschränkungen, wen sie akzeptieren wollen. Das Gleiche betrifft geborene Juden, die erst später im Leben religiös geworden sind. Auch sie haben mit entsprechenden Vorurteilen zu kämpfen.
Nicht jeder in relig. Kreisen missachtet diese Halacha und nicht alle hetzen nun gegen Konvertiten oder Baalei Teshuva. Anzumerken aber bleibt, dass es eben doch viele tun, wenn manchmal auch nur mit verbalen Hinweisen. Was zu früherer Zeit als eine große Tat angesehen wurde (alles aufzugeben und sein Leben neu und relig. zu gestalten), wird jetzt oft mit Mißtrauen begegnet. Anscheinend auch, weil viele geborene Religiöse negative Erfahrungen mit Konvertiten oder Baalei Teshuva machten. Die Presse tut da oftmals ihr Übriges, wenn sie ausgerechnet die "falschen" Konvertiten in die Schlagzeilen hievt und nicht jene, die sich sehr wohl ein jüdisch relig. Leben aufbauen wollen. Ebenso mit den Baalei Teshuva, von denen vielfach behauptet wird, sie seien vorher kriminell (Drogen etc.) gewesen.
Im Talmud ist diese Halacha nur kurz erwähnt, dennoch halte ich sie für bedeutsam. Unter anderem auch, weil immer wieder diverse Bemerkungen kommen, ohne das es derjenige vielleicht beabsichtigte.
Ein Yeshivalehrer von mir war ein Baal Teshuva und zuvor hatte er ein recht wildes sekuläres Leben geführt. Eine Mitschülerin machte diesbezüglich einmal eine spitze Bemerkung auf die er recht harsch reagierte. Man solle niemandem, der jetzt eindeutig relig. lebe vorwerfen, welche Fehler er in den vorherigen Jahren begangen habe. Wer sei denn derjenige, der soetwas sagt. Weiß er vielleicht besser als G - tt, was in dem Menschen heute vorgehe ?
Labels:
Baal Teshuva,
Giur,
Halacha,
Talmud
Parashat Va'era
B"H
Die Thoralesung für diesen Schabbat
Die dieswöchige Parasha ist dermassen interessant, dass die Themenauswahl schwer fällt. Zwar habe ich viele Kommentare schon gelesen, befinde mich aber dennoch noch in der Mitte weiterer Kommentare. Die Meinungen und Deutungen scheinen kein Ende zu nehmen und am Schabbat werde ich sicher weiter damit beschäftigt sein.
Bei den Schabbatessen, zu denen wir allwöchentlich gehen, kommen Rabbi Mordechai Machlis und viele andere Leute zu Wort, was die Sache noch interessanter macht. Gespickt mit persönlichen Erlebnissen zur Thoralesung, kann jeder noch so Desinteressierte einiges nachvollziehen und wird hellhörig.
Aber auch an dieser Stelle zuerst die ernsteren Thorakommentare, bevor ich zum Persönlichen komme.
Am Ende der letzten Parashat Schemot beschwerte sich Moshe bei G – tt, dass er zwar bei Pharao gewesen sei und ihm gesagt habe, er solle die Israeliten freilassen, aber sich hinterher alles als umsonst herausgestellt habe. Im Gegenteil, Pharao war nicht gerade angetan und halste den Israeliten gleich noch mehr Arbeit auf (Talmud Sanhedrin 111a).
Wozu das Ganze also ?
In dieser Parasha gab G – tt Seine Antwort auf den sich beschwerenden Moshe und sagte ihm die Meinung. Den Vorvätern Avraham, Yitzchak und Yaakov sei Er nur unter dem Namen E"l Shadda"i erschienen und ihm (Moshe) immerhin unter G – ttes höchstem Namen Y – H – V – H. Sprich, noch nicht einmal die Vorväter sahen eine nicht offensichtliche Seite G – ttes, die Moshe jetzt sieht.
Die recht einfach erscheinenden Worte zu Beginn der Parashat Va'era haben unendlich viele Kommentare erzeugt und ich will einige wichtige davon nennen.
Vorab erst einmal die Frage, was genau G – ttes Namen für eine Bedeutung haben und wieso Er sich unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Namen präsentiert.
G – ttes Namen drücken IMMER eine bestimmte Eigenschaft von Ihm aus. Beispiel: Wie wird er handeln.
Der berühmte chassidische Rabbiner Elimelech von Lejansk schreibt in seinem Buch "Noam Elimelech", dass G – tt sich dem Menschen gemäss dessen individuellem Level zeigt. So auch im Falle des Moshe. Dieses bedeutet wiederum NICHT, dass G – tt plötzlich ein anderer ist, nur weil Er unter anderem Namen erscheint. G – tt bleibt immer der Gleiche, nur handelt Er anders. Und der Level eines Menschen hängt in diesem Falle von der Erfüllung der Thoragebote ab.
Was aber genau unterscheidet den Namen E"l Shadda"i von dem Namen, der Moshe genannt wurde, Y – H – V – H ?
Im kabbalistischen Buch Zohar lesen wir, dass G – tt anhand Seines höchsten Namens Y – H – V - H die Welt erschuf. Außerdem zeigte sich G – tt den Vorvätern in deren Prophezeihungen nur des nachts (Ibn Ezra) und nicht zu jeder Tageszeit wie dem Moshe. Seit Moshe gab es nie wieder einen Menschen, der mit G – tt von "Angesicht zu Angesicht" sprach und sich auf solch höchstem Level der Prohpezeihung befand.
Von Angesicht zu Angesicht darf keinesfalls wörtlich genommen werden, denn niemand sieht G –tt auch nur annähernd. Vielmehr wird uns hier eine Metapher in vermenschlichter Sprache gegeben, zu der unser begrenztes Fassungsvermögen einen Zugang haben kann.
Der erste aschkenazische Oberrabbiner, Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook (Kuk), kommentierte, dass sich G – tt nun mit Seinem höchsten Namen präsentieren konnte, denn Israel war auf einem hohen Level, da sie in Ägypten zu einer Nation herangewachsen waren.
Unsere Vorväter hatten gar keinen Bedarf für diesen hohen Namen Y – H – V – H, da ihnen keine offenen Wunder, welche die Natur verändern sollten, wiederfuhren. Bei den Israeliten aber sollte dies anders sein, denn G – tt vollbrachte für sie offene Wunder; zuerst beim Auszug aus Ägypten und später in der Wüste (Ramban sowie Sforno).
Des weiteren vertrauten die Vorväter ganz einfach auf G – tt und fragten nie nach oder beschwerten sich. Moshe hingegen war nur auf eine schnelle Lösung aus a la "Ich war bei Pharao, der tut nichts, also G – tt tu Du etwas".
Aufgrund ihres blinden G – ttvertrauens benötigten die Vorväter niemals den Namen Y – H – V – H (der chassidische Kommentator Kli Yakar). Dies wiederum aber bedeutet nicht, dass sie den Namen nicht kannten. Laut des Ramban wußten die Vorväter sehr wohl von dem Namen, gaben sich aber dennoch mit E"l Shadda"i zufrieden.
Der derzeitige Rebbe der chassidischen Gruppe Slonim in Jerusalem, Rabbi Bozorowsky, verfasst meiner Meinung nach brilliante Thorakommentare und auch an dieser Stelle hält er eine exzellente Meinung bereit: Die Israeliten hatten in der äyptischen Diaspora schweren spirituellen Schaden erlitten und waren dabei, G – tt zu vergessen. Sie hatten andere Probleme als die Religion und waren vom täglichen Arbeitspensum so müde, dass sie abends heimkamen, aßen und sich schlafen legten. Wen interessierte da groß G – tt ?
Die Diaspora in Ägypten jedoch war eine Diaspora des "Wissens (Daat)", was voraussetzte, dass alle G – tt kennen mußten. Deswegen benutzte G – tt Seinen höchsten Namen, denn nach all den Jahren besassen die Israeliten nicht mehr das Wissen ihrer Vorväter, das da EIN G – tt ist, der die Welt erschuf.
Was mich bei der Aufzählung der Zehn Plagen immer störte war, wenn es da in der Thora heißt, dass G – tt Pharaos Herz erhärtete.
Was genau soll das bedeuten ? War es nicht Pharaos Entscheidung, die Israeliten gehen zu lassen oder nicht ? Was hat G – tt mit dessen Entscheidung zu tun ?
An dieser Stelle stellt sich einmal wieder mehr die Frage, inwieweit die Menschen einen freien Willen haben und inwieweit G – tt alles beeinflußt. Es heißt, dass Pharao bis zur fünften Plage über einen freien Willen verfügte und danach nicht mehr. Ab der sechsten Plage sorgte G – tt dafür, dass Pharao keinerlei freie Entscheidungen mehr treffen konnte und dementsprechend die Israeliten nicht gehen liess.
Wieso tat G – tt das ?
Der Ramban sowie Ibn Ezra geben eine einfache kurze Antwort, welche genauer definiert werden muß: G – tt wollte verhindern, dass Pharao Teshuva macht. Teshuva bedeutet eine Umkehr zu G – tt.
Wenn jemand sündigt bzw. etwas Falsches tut, dann läßt G – tt normalerweise Gnade walten, wenn derjenige Reue zeigt und ernsthafte Besserung gelobt.
Laut dem Rambam (Maimonides) und seiner Mishna Thora – Hilchot Teshuva 5:6, kann G – tt einem Menschen die Teshuva bzw. Gnade verweigern, selbst wenn dieser Reue zeigen täte. In diesem Fall gibt G – tt dem Sünder vorher unzählige Zeichen, die auf eine eventuelle Reue hindeuten sollen. Erkennt derjenige G – ttes Signale nicht und fährt mit seinem Verhalten fort, richtet G – tt es ein, dass derjenige sein Leben genauso verendet und mit seinen Vergehen stirbt.
Bestes Beispiel ist, wenn Hitler plötzlich Reue gezeigt und sich entschuldigt hätte. Ab einem gewissen Zeitpunkt war der Zeitpunkt der Reue für Hitler absolut unmöglich und die Kabbalah könnte mit einbringen, dass nach dessen Tode sogar seine Seele zerstört wurde.
Nicht in allen Fällen dürfen wir uns immer auf G – ttes Gnade verlassen und sollten daher zusehen, es nie zu weit kommen zu lassen. Aber nicht alle sind Pharao oder Hitler und von daher ist Otto Normalverbraucher nicht unbedingt in irgendeiner Gefahr. Die Worte des Rambams sind immer kurz und präzise und bilden für das Verhalten Pharaos eine ausreichende Erklärung.
Schon in der vorherigen Parasha rechtfertigte sich Moshe damit, Probleme beim Sprechen zu haben. Kommentatoren sagen, dass Moshe stotterte.
Auch am letzten Schabbat fragte Rabbi Machlis, warum G – tt gerade jemanden, der stottert, zur Rettung des Volkes Israel auserkoren hatte. Hätte er nicht jemanden finden können, der gut spricht und ein entsprechendes Charisma bietet ?
Anscheinend soll hier gelehrt werden, dass es manchmal Menschen gibt, die in unseren Augen unwichtig erscheinen oder wir meinen, dass sie auf einem niedrigen Stand sind und eh keine Chancen haben. Das genaue Gegenteil aber beweist uns Moshe, der trotz seiner Behinderung zum größten Propheten aufstieg.
Schabbat Schalom
Die Thoralesung für diesen Schabbat
Die dieswöchige Parasha ist dermassen interessant, dass die Themenauswahl schwer fällt. Zwar habe ich viele Kommentare schon gelesen, befinde mich aber dennoch noch in der Mitte weiterer Kommentare. Die Meinungen und Deutungen scheinen kein Ende zu nehmen und am Schabbat werde ich sicher weiter damit beschäftigt sein.
Bei den Schabbatessen, zu denen wir allwöchentlich gehen, kommen Rabbi Mordechai Machlis und viele andere Leute zu Wort, was die Sache noch interessanter macht. Gespickt mit persönlichen Erlebnissen zur Thoralesung, kann jeder noch so Desinteressierte einiges nachvollziehen und wird hellhörig.
Aber auch an dieser Stelle zuerst die ernsteren Thorakommentare, bevor ich zum Persönlichen komme.
Am Ende der letzten Parashat Schemot beschwerte sich Moshe bei G – tt, dass er zwar bei Pharao gewesen sei und ihm gesagt habe, er solle die Israeliten freilassen, aber sich hinterher alles als umsonst herausgestellt habe. Im Gegenteil, Pharao war nicht gerade angetan und halste den Israeliten gleich noch mehr Arbeit auf (Talmud Sanhedrin 111a).
Wozu das Ganze also ?
In dieser Parasha gab G – tt Seine Antwort auf den sich beschwerenden Moshe und sagte ihm die Meinung. Den Vorvätern Avraham, Yitzchak und Yaakov sei Er nur unter dem Namen E"l Shadda"i erschienen und ihm (Moshe) immerhin unter G – ttes höchstem Namen Y – H – V – H. Sprich, noch nicht einmal die Vorväter sahen eine nicht offensichtliche Seite G – ttes, die Moshe jetzt sieht.
Die recht einfach erscheinenden Worte zu Beginn der Parashat Va'era haben unendlich viele Kommentare erzeugt und ich will einige wichtige davon nennen.
Vorab erst einmal die Frage, was genau G – ttes Namen für eine Bedeutung haben und wieso Er sich unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Namen präsentiert.
G – ttes Namen drücken IMMER eine bestimmte Eigenschaft von Ihm aus. Beispiel: Wie wird er handeln.
Der berühmte chassidische Rabbiner Elimelech von Lejansk schreibt in seinem Buch "Noam Elimelech", dass G – tt sich dem Menschen gemäss dessen individuellem Level zeigt. So auch im Falle des Moshe. Dieses bedeutet wiederum NICHT, dass G – tt plötzlich ein anderer ist, nur weil Er unter anderem Namen erscheint. G – tt bleibt immer der Gleiche, nur handelt Er anders. Und der Level eines Menschen hängt in diesem Falle von der Erfüllung der Thoragebote ab.
Was aber genau unterscheidet den Namen E"l Shadda"i von dem Namen, der Moshe genannt wurde, Y – H – V – H ?
Im kabbalistischen Buch Zohar lesen wir, dass G – tt anhand Seines höchsten Namens Y – H – V - H die Welt erschuf. Außerdem zeigte sich G – tt den Vorvätern in deren Prophezeihungen nur des nachts (Ibn Ezra) und nicht zu jeder Tageszeit wie dem Moshe. Seit Moshe gab es nie wieder einen Menschen, der mit G – tt von "Angesicht zu Angesicht" sprach und sich auf solch höchstem Level der Prohpezeihung befand.
Von Angesicht zu Angesicht darf keinesfalls wörtlich genommen werden, denn niemand sieht G –tt auch nur annähernd. Vielmehr wird uns hier eine Metapher in vermenschlichter Sprache gegeben, zu der unser begrenztes Fassungsvermögen einen Zugang haben kann.
Der erste aschkenazische Oberrabbiner, Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook (Kuk), kommentierte, dass sich G – tt nun mit Seinem höchsten Namen präsentieren konnte, denn Israel war auf einem hohen Level, da sie in Ägypten zu einer Nation herangewachsen waren.
Unsere Vorväter hatten gar keinen Bedarf für diesen hohen Namen Y – H – V – H, da ihnen keine offenen Wunder, welche die Natur verändern sollten, wiederfuhren. Bei den Israeliten aber sollte dies anders sein, denn G – tt vollbrachte für sie offene Wunder; zuerst beim Auszug aus Ägypten und später in der Wüste (Ramban sowie Sforno).
Des weiteren vertrauten die Vorväter ganz einfach auf G – tt und fragten nie nach oder beschwerten sich. Moshe hingegen war nur auf eine schnelle Lösung aus a la "Ich war bei Pharao, der tut nichts, also G – tt tu Du etwas".
Aufgrund ihres blinden G – ttvertrauens benötigten die Vorväter niemals den Namen Y – H – V – H (der chassidische Kommentator Kli Yakar). Dies wiederum aber bedeutet nicht, dass sie den Namen nicht kannten. Laut des Ramban wußten die Vorväter sehr wohl von dem Namen, gaben sich aber dennoch mit E"l Shadda"i zufrieden.
Der derzeitige Rebbe der chassidischen Gruppe Slonim in Jerusalem, Rabbi Bozorowsky, verfasst meiner Meinung nach brilliante Thorakommentare und auch an dieser Stelle hält er eine exzellente Meinung bereit: Die Israeliten hatten in der äyptischen Diaspora schweren spirituellen Schaden erlitten und waren dabei, G – tt zu vergessen. Sie hatten andere Probleme als die Religion und waren vom täglichen Arbeitspensum so müde, dass sie abends heimkamen, aßen und sich schlafen legten. Wen interessierte da groß G – tt ?
Die Diaspora in Ägypten jedoch war eine Diaspora des "Wissens (Daat)", was voraussetzte, dass alle G – tt kennen mußten. Deswegen benutzte G – tt Seinen höchsten Namen, denn nach all den Jahren besassen die Israeliten nicht mehr das Wissen ihrer Vorväter, das da EIN G – tt ist, der die Welt erschuf.
Was mich bei der Aufzählung der Zehn Plagen immer störte war, wenn es da in der Thora heißt, dass G – tt Pharaos Herz erhärtete.
Was genau soll das bedeuten ? War es nicht Pharaos Entscheidung, die Israeliten gehen zu lassen oder nicht ? Was hat G – tt mit dessen Entscheidung zu tun ?
An dieser Stelle stellt sich einmal wieder mehr die Frage, inwieweit die Menschen einen freien Willen haben und inwieweit G – tt alles beeinflußt. Es heißt, dass Pharao bis zur fünften Plage über einen freien Willen verfügte und danach nicht mehr. Ab der sechsten Plage sorgte G – tt dafür, dass Pharao keinerlei freie Entscheidungen mehr treffen konnte und dementsprechend die Israeliten nicht gehen liess.
Wieso tat G – tt das ?
Der Ramban sowie Ibn Ezra geben eine einfache kurze Antwort, welche genauer definiert werden muß: G – tt wollte verhindern, dass Pharao Teshuva macht. Teshuva bedeutet eine Umkehr zu G – tt.
Wenn jemand sündigt bzw. etwas Falsches tut, dann läßt G – tt normalerweise Gnade walten, wenn derjenige Reue zeigt und ernsthafte Besserung gelobt.
Laut dem Rambam (Maimonides) und seiner Mishna Thora – Hilchot Teshuva 5:6, kann G – tt einem Menschen die Teshuva bzw. Gnade verweigern, selbst wenn dieser Reue zeigen täte. In diesem Fall gibt G – tt dem Sünder vorher unzählige Zeichen, die auf eine eventuelle Reue hindeuten sollen. Erkennt derjenige G – ttes Signale nicht und fährt mit seinem Verhalten fort, richtet G – tt es ein, dass derjenige sein Leben genauso verendet und mit seinen Vergehen stirbt.
Bestes Beispiel ist, wenn Hitler plötzlich Reue gezeigt und sich entschuldigt hätte. Ab einem gewissen Zeitpunkt war der Zeitpunkt der Reue für Hitler absolut unmöglich und die Kabbalah könnte mit einbringen, dass nach dessen Tode sogar seine Seele zerstört wurde.
Nicht in allen Fällen dürfen wir uns immer auf G – ttes Gnade verlassen und sollten daher zusehen, es nie zu weit kommen zu lassen. Aber nicht alle sind Pharao oder Hitler und von daher ist Otto Normalverbraucher nicht unbedingt in irgendeiner Gefahr. Die Worte des Rambams sind immer kurz und präzise und bilden für das Verhalten Pharaos eine ausreichende Erklärung.
Schon in der vorherigen Parasha rechtfertigte sich Moshe damit, Probleme beim Sprechen zu haben. Kommentatoren sagen, dass Moshe stotterte.
Auch am letzten Schabbat fragte Rabbi Machlis, warum G – tt gerade jemanden, der stottert, zur Rettung des Volkes Israel auserkoren hatte. Hätte er nicht jemanden finden können, der gut spricht und ein entsprechendes Charisma bietet ?
Anscheinend soll hier gelehrt werden, dass es manchmal Menschen gibt, die in unseren Augen unwichtig erscheinen oder wir meinen, dass sie auf einem niedrigen Stand sind und eh keine Chancen haben. Das genaue Gegenteil aber beweist uns Moshe, der trotz seiner Behinderung zum größten Propheten aufstieg.
Schabbat Schalom
Labels:
Thora Parasha
Mittwoch, Januar 02, 2008
Das Bewegen der Lippen ist verboten ! ! !
B"H
Es ist schon längst keine Neuigkeit mehr, dass Juden bei einem Besuch auf dem Tempelberg (Har HaBait) nicht offen beten dürfen.
Wer sich als Jude entschließt, den Tempelberg zu besuchen, der wird auf eine spezielle Art und Weise von der israel. Polizei begleitet. Zuerst wird ein jeder natürlich auf Waffen durchsucht und danach die ganze Tour über begleitet. Zum Schutz vor den Palästinensern, versteht sich.
Aber die israel. Polizei hat Anweisung, auch auf die Münder der Juden zu achten. Wer seine Lippen auch nur vorsichtig bewegt und ein eventuelles Gebet spricht, wird unverzüglich des Platzes verwiesen. Dieses Verbot wird nun aktuell und nicht aufgehoben.
Offensichtlich kennen sich die Moslems besser in der jüdischen Religion aus als die israel. Polizei, denn bei den Moslems weiß man, dass Gebete von Juden auf dem Tempelberg den Meschiach bringen könnten. Demzufolge bedeute dies das Ende der islamischen Herrschaft, denn der jüdische Meschiach poche an die Pforten. Naiverweise will man dies durch ein Bet - Verbot verhindern und die israel. Regierung spielt mit, um keine Konflikte mit der islamischen Tempelwache Wakf zu schüren.
Religiöse Juden dagegen sagen, dass kein Mensch auf der Welt einem Juden verbieten kann, mit seinem Schöpfer zu reden. Und die Regierung Olmert schon gleich gar nicht. Dennoch besteht die Regierung darauf: Die Lippen werden auch weiterhin nicht bewegt und wer sich rührt, fliegt raus.
Stellt sich die Frage, was die Regierung samt Polizei einmal G - tt antworten, wenn dieser sie nach ihren Missetaten befragt.
Und wer die Halacha kennt, dem ist klar, dass in bestimmten Situationen gedachte Gebete genauso zählen. Aber wer weiß, vielleicht wird das Denken demnächst auch noch verboten.
Es ist schon längst keine Neuigkeit mehr, dass Juden bei einem Besuch auf dem Tempelberg (Har HaBait) nicht offen beten dürfen.
Wer sich als Jude entschließt, den Tempelberg zu besuchen, der wird auf eine spezielle Art und Weise von der israel. Polizei begleitet. Zuerst wird ein jeder natürlich auf Waffen durchsucht und danach die ganze Tour über begleitet. Zum Schutz vor den Palästinensern, versteht sich.
Aber die israel. Polizei hat Anweisung, auch auf die Münder der Juden zu achten. Wer seine Lippen auch nur vorsichtig bewegt und ein eventuelles Gebet spricht, wird unverzüglich des Platzes verwiesen. Dieses Verbot wird nun aktuell und nicht aufgehoben.
Offensichtlich kennen sich die Moslems besser in der jüdischen Religion aus als die israel. Polizei, denn bei den Moslems weiß man, dass Gebete von Juden auf dem Tempelberg den Meschiach bringen könnten. Demzufolge bedeute dies das Ende der islamischen Herrschaft, denn der jüdische Meschiach poche an die Pforten. Naiverweise will man dies durch ein Bet - Verbot verhindern und die israel. Regierung spielt mit, um keine Konflikte mit der islamischen Tempelwache Wakf zu schüren.
Religiöse Juden dagegen sagen, dass kein Mensch auf der Welt einem Juden verbieten kann, mit seinem Schöpfer zu reden. Und die Regierung Olmert schon gleich gar nicht. Dennoch besteht die Regierung darauf: Die Lippen werden auch weiterhin nicht bewegt und wer sich rührt, fliegt raus.
Stellt sich die Frage, was die Regierung samt Polizei einmal G - tt antworten, wenn dieser sie nach ihren Missetaten befragt.
Und wer die Halacha kennt, dem ist klar, dass in bestimmten Situationen gedachte Gebete genauso zählen. Aber wer weiß, vielleicht wird das Denken demnächst auch noch verboten.
Labels:
Israel. - Arab. Konflikt,
Politk
Chassidische Erzählungen
B"H
Einige Leser fragten nach, wo denn die chassidischen Erzählungen bzw. Berichte aus Jerusalem bleiben. Gibt es keine Neuigkeiten mehr in der chassidischen Welt ?
Tatsache ist, dass es eine Menge zu berichten gibt, doch habe ich die Chassidut etwas von "Hamantaschen" abgespalten, da sie einen immer größeren Raum einnimmt.
Daher gibt es für alle Interessenten am Chassidismus auf einem extra eingerichteten Blog alles aus der Welt zu lesen.
http://chassidicstories.blogspot.com
Darunter private Artikel, aber auch in Kürze einen Bericht über die Verhaftung des Rebben der Chassidut Spinka wegen Steuerhinterziehung sowie einige neue interne Regeln der Chassidut Satmar.
Einige Leser fragten nach, wo denn die chassidischen Erzählungen bzw. Berichte aus Jerusalem bleiben. Gibt es keine Neuigkeiten mehr in der chassidischen Welt ?
Tatsache ist, dass es eine Menge zu berichten gibt, doch habe ich die Chassidut etwas von "Hamantaschen" abgespalten, da sie einen immer größeren Raum einnimmt.
Daher gibt es für alle Interessenten am Chassidismus auf einem extra eingerichteten Blog alles aus der Welt zu lesen.
http://chassidicstories.blogspot.com
Darunter private Artikel, aber auch in Kürze einen Bericht über die Verhaftung des Rebben der Chassidut Spinka wegen Steuerhinterziehung sowie einige neue interne Regeln der Chassidut Satmar.
Dienstag, Januar 01, 2008
Wieviel kostet das ?
B"H
Der Talmud Traktat Bava Metziah 58b spricht ein so alltägliches Thema an, bei dem, wenn wir in die Lage geraten, wir gar nicht mehr groß über unser Tun nachdenken.
Die Mishna (mündliche Überlieferung G - ttes an Moshe auf dem Berg Sinai) sagt folgendes:
Genauso wie ein falsches Verhalten beim Kauf und Verkauf vorhanden sein kann, geschieht dies dabei auch mit Worten.
Jemand sollte nicht sagen: "Wieviel kostet das", wenn er nicht beabsichtigt, den Gegenstand zu erwerben.
Die gleiche Mishna führt noch weitere Beispiele an, doch wollen wir vorerst bei dem obigen Thema bleiben.
Ein "potentieller Kunde" soll einen Verkäufer nicht nach einem Preis der Ware fragen, wenn er nicht vorher beabsichtigt, den Gegenstand auch wirklich zu kaufen. Heißt, einfach nur so aus Langeweile fragt.
Der große Talmudkommentator Me'iri (Rabbi Menachem Me'iri aus der Provence, 1249 - 1310) erklärt Einzelheiten:
Sobald der "potentielle Kunde" erst einmal nach dem Preis gefragt hat, wird er kaum zugeben, dass er keinerlei Absicht hegt, den Gegenstand zu erwerben. Vielmehr wird er sich einfach wortlos entfernen. Mit dieser Art des "Sich Entfernens" erweckt er den Eindruck, dass die Ware den Preis nicht wert sei.
Wenn andere Kunden von diesem Vorfall hören, könnte der Verkäufer gezwungen sein, den Preis der Ware herabzusetzen und erleidet somit einen finanziellen Verlust. Aber selbst wenn kein anderer Kunde den Vorfall beobachtet hat, ist der Verkäufer verärgert über das Verhalten des "potentiellen Kunden".
In beiden Fällen tat der "potentielle Kunde" dem Verkäufer unrecht.
Rabbi Elazar sagt in der gleichen Gemara (rabbinische Diskussionen), dass dieses verbale falsche Verhalten des "potentiellen Kunden" schwerwiegender ist als ein falsches Verhalten während des Kaufes selbst (z.B. ein zu hoher Preis).
Als Grund nennt er dafür, dass bei dieser Art von Verhalten nicht nur die Geldbörse des Verkäufers angegriffen wird, sondern vielmehr dessen innere Persönlichkeit.
Rabbi Shmuel bar Nachmani fügt hinzu, dass ein eventuell erlittener finanzieller Verlust durch einen Schadenersatz wettgemacht werden könnte, aber in diesem Fall der Verkäufer mental verletzt wurde und dies nicht wettzumachen ist. Selbst bei einer Entschuldigung bleibe immer ein bitterer Nachgeschmack.
Rashi fragt dazu eine hervorragende Frage; nämlich die, wie denn der Verkäufer wissen soll, dass der "potentielle Kunde" die Ware nicht doch kaufen wollte und daher nach dem Preis fragte. Wie kann er dann beleidigt sein ?
Rashis Antwort ist simpel:
Natürlich kann der Verkäufer die wahre Absicht seiner Kundschaft nicht voraussehen, aber G - tt kann es. G - tt weiß, was jeder Mensch denkt und kann dementsprechend denjenigen bestrafen. Der "potentielle Kunde" kann vielleicht dem Verkäufer etwas vormachen, aber nicht G - tt.
Wie oft erleben wir es, dass jemand an einen Stand kommt und sich eine Frucht oder Ähnliches herauspickt und ißt. Natürlich nur um zu probieren und zu testen, ob die Ware es wert ist, gekauft zu werden. Auch dieses Verhalten ist lt. des Talmuds falsch, wenn derjenige niemals vorhatte, die Ware wirklich zu kaufen, sondern sich nur auf Kosten des Händlers vollstopft.
Vielleicht helfen diese kleinen Halachot (Gesetze) dem ein oder anderen in seinem Alltag mehr nachzudenken. Vor allem aber den Verkäufern.
Der Talmud Traktat Bava Metziah 58b spricht ein so alltägliches Thema an, bei dem, wenn wir in die Lage geraten, wir gar nicht mehr groß über unser Tun nachdenken.
Die Mishna (mündliche Überlieferung G - ttes an Moshe auf dem Berg Sinai) sagt folgendes:
Genauso wie ein falsches Verhalten beim Kauf und Verkauf vorhanden sein kann, geschieht dies dabei auch mit Worten.
Jemand sollte nicht sagen: "Wieviel kostet das", wenn er nicht beabsichtigt, den Gegenstand zu erwerben.
Die gleiche Mishna führt noch weitere Beispiele an, doch wollen wir vorerst bei dem obigen Thema bleiben.
Ein "potentieller Kunde" soll einen Verkäufer nicht nach einem Preis der Ware fragen, wenn er nicht vorher beabsichtigt, den Gegenstand auch wirklich zu kaufen. Heißt, einfach nur so aus Langeweile fragt.
Der große Talmudkommentator Me'iri (Rabbi Menachem Me'iri aus der Provence, 1249 - 1310) erklärt Einzelheiten:
Sobald der "potentielle Kunde" erst einmal nach dem Preis gefragt hat, wird er kaum zugeben, dass er keinerlei Absicht hegt, den Gegenstand zu erwerben. Vielmehr wird er sich einfach wortlos entfernen. Mit dieser Art des "Sich Entfernens" erweckt er den Eindruck, dass die Ware den Preis nicht wert sei.
Wenn andere Kunden von diesem Vorfall hören, könnte der Verkäufer gezwungen sein, den Preis der Ware herabzusetzen und erleidet somit einen finanziellen Verlust. Aber selbst wenn kein anderer Kunde den Vorfall beobachtet hat, ist der Verkäufer verärgert über das Verhalten des "potentiellen Kunden".
In beiden Fällen tat der "potentielle Kunde" dem Verkäufer unrecht.
Rabbi Elazar sagt in der gleichen Gemara (rabbinische Diskussionen), dass dieses verbale falsche Verhalten des "potentiellen Kunden" schwerwiegender ist als ein falsches Verhalten während des Kaufes selbst (z.B. ein zu hoher Preis).
Als Grund nennt er dafür, dass bei dieser Art von Verhalten nicht nur die Geldbörse des Verkäufers angegriffen wird, sondern vielmehr dessen innere Persönlichkeit.
Rabbi Shmuel bar Nachmani fügt hinzu, dass ein eventuell erlittener finanzieller Verlust durch einen Schadenersatz wettgemacht werden könnte, aber in diesem Fall der Verkäufer mental verletzt wurde und dies nicht wettzumachen ist. Selbst bei einer Entschuldigung bleibe immer ein bitterer Nachgeschmack.
Rashi fragt dazu eine hervorragende Frage; nämlich die, wie denn der Verkäufer wissen soll, dass der "potentielle Kunde" die Ware nicht doch kaufen wollte und daher nach dem Preis fragte. Wie kann er dann beleidigt sein ?
Rashis Antwort ist simpel:
Natürlich kann der Verkäufer die wahre Absicht seiner Kundschaft nicht voraussehen, aber G - tt kann es. G - tt weiß, was jeder Mensch denkt und kann dementsprechend denjenigen bestrafen. Der "potentielle Kunde" kann vielleicht dem Verkäufer etwas vormachen, aber nicht G - tt.
Wie oft erleben wir es, dass jemand an einen Stand kommt und sich eine Frucht oder Ähnliches herauspickt und ißt. Natürlich nur um zu probieren und zu testen, ob die Ware es wert ist, gekauft zu werden. Auch dieses Verhalten ist lt. des Talmuds falsch, wenn derjenige niemals vorhatte, die Ware wirklich zu kaufen, sondern sich nur auf Kosten des Händlers vollstopft.
Vielleicht helfen diese kleinen Halachot (Gesetze) dem ein oder anderen in seinem Alltag mehr nachzudenken. Vor allem aber den Verkäufern.
Die jüdische Phobie
B"H
In meiner vorherigen Umfrage ging es um das Thema: "Sollen Vorträge zum Judentum nur vor jüdischem Publikum gehalten werden ?"
Zwei Antworten machten bei den Abstimmenden das Rennen:
1. Das Publikum sei egal, Hauptsache man lerne etwas.
2. Es ist relevanter, zuerst Juden das Judentum zu vermitteln.
Ich selbst halte es mit der letzten Antwort. Leider ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Juden auf aller Welt nur geringe Kenntnisse über ihre eigene Religion hat. Die Gründe sind, wie so häufig, unterschiedlich. Nur von mangelndem Interesse zu reden ist falsch. Vielmals liegt Interesse vor, nur fehlt es vor allem in Deutschland an qualifizierten Einrichtungen, in denen jemand ernsthaft über das Judentum unterrichtet wird.
Mit die einzige qualifizierte Einrichtung ist CHABAD, die Lubawitscher Chassidim, und wie ich Chabad kenne, werden dort NUR halachische Juden unterrichtet. Kein Wunder, denn das Chabad – Pensum ist keine leichte Kost und erfordert viel Einsatz. Wer wirklich interessiert ist, dem kann ich die Chabad – Shiurim nur weiterempfehlen. Wer da meint, die reden dann eh nur vom Meschiach oder Ähnlichem, der liegt falsch, denn Chabad lehrt alle Themen im Judentum. Von der Halacha über den Talmud bis hin zur Chassidut.
Was immer wieder von deutschen jüdischen Lesern bemängelt wird, ist der fehlende jüdische Bekanntenkreis. Natürlich kann jeder auch nichtjüdische Freunde haben, doch dies räumt das Gefühl nicht aus, dass immer etwas fehlt. Man will auch einmal unter sich sein und über ganz bestimmte Themen reden. Das ist nur allzu verständlich.
Eine Patenlösung für den fehlenden jüdischen Freundeskreis in Deutschland gibt es nicht. Entweder sucht man sich etwas Virtuelles im Internet, zieht dorthin, wo man auf einen derartigen Bekanntenkreis trifft (Berlin oder Frankfurt) oder man geht ins Ausland. Letzteres geschieht in letzter Zeit sehr häufig und nicht wenige junge deutsche Juden ziehen nach London oder New York. Insbesondere jene, die ein relig. Leben führen wollen.
Vielleicht sollte sich in Deutschland an sich einmal gefragt werden, warum in dessen Nachbarländern wie der Schweiz (Basel und Zürich), Belgien (Antwerpen) oder Österreich sehr wohl ein jüdisch – religiöses Leben stattfinden kann. Wie kommt es, dass sich sogar viele Chassidim in Wien niederlassen ? Wieso wird ausgerechnet dort eine dementsprechende Infrastruktur aufgebaut ?
Meine deutsche Erfahrung war, dass sich die orthod. Gemeinden immer selbst blockieren. Die dortigen Gemeinderabbiner wollen einfach niemanden neben sich wirken haben, denn sonst könnten die Schäfchen woanders hin überlaufen und der Gemeinderabbi steht allein da. Aber wie man so schön sagt: "Konkurrenz belebt das Geschäft" und zumindest Chabad kam gerade recht, um deutschen Juden einmal ein wenig Wissen zu vermitteln, was sie woanders kaum oder nur begrenzt bekommen.
Aber zurück zur vorherigen Umfrage.
Ich finde es äußerst wichtig, dass zuerst Juden unterrichtet werden. Wozu sollte sich jemand hinstellen und vor einem gemischten Publikum über die Kaschrut oder den Schabbat sprechen, wenn die Nichtjuden im Publikum dieses Thema gar nichts angeht ? Allgemeinere Themen dagegen können vor einem gemischten Publikum stattfinden, doch halte ich es immer so, dass ich Abstriche mache. Heißt, gewisse Dinge erwähne ich nur vor einem rein jüdischen Publikum. Genauso halt es übrigens mein Rabbi, Rabbi Mordechai Machlis.
Aber das wiederum geht im Endeffekt auf Kosten der jüdischen Zuhörer, denn sollten sie bei einem Vortrag vor Juden und Nichtjuden dabei sein, erfahren sie nur die Hälfte.
Bisher habe ich nur begrenzte Vortragserfahrung und wenn, dann ausschließlich vor amerikanischen Juden. Ein Freund von mir, David Salomon, gab mir seine Vortragserfahrungen weiter.
Er unterrichte ausschließlich nur Juden und seine Gründen waren die gleichen wie die meinen. Es sei wichtig, dass vorzugsweise die Juden selbst etwas über ihre eigene Religion und Identität lernen.
Als ich in der vergangenen Woche bei einem Shiur (Vortrag) war, sprach mich der Referent, Rabbi Chaim Eisen, an. In der Woche zuvor hatte ich mit ihm eine Diskussion über den Rambam, die wir gleich zu Beginn des Shiurs vor dem Publikum fortsetzten.
Hierbei ging es auch darum, dass der Rambam (Maimonides) sowie viele andere Thorakommentatoren (z.B. Rashi) es komplett ablehnen, wenn ein Nichtjude die Thora lernt. Zwar heisst in es in mindestens zwei Talmud – Traktaten (u.a. in Talmud Avodah Zarah 3a), dass ein Nichtjude, der sich mit der Thora beschäftigt, genauso anzusehen ist, wie ein Hohepriester (Cohen HaGadol). Doch der Rambam, Rashi, und andere kommentieren, dass dieser Passuk meint, ein Nichtjude solle sich ausschließlich mit denjenigen Thoralehren, welche sich mit den "Sieben Gesetzen der Noachiden" auseinandersetzen.
Rabbi Eisen merkte an, dass zu diesen Meinungen ein Disput entstand und andere wiederum die Ansicht vertreten, dass ein Nichtjude dann die Thora bzw. weitere jüdische Themen lernen darf, wenn er wirkliches Interesse zeigt und das Gelernte nicht falsch wiedergibt oder für christliche Missionszwecke ausnutzen will. Sprich, Gelerntes so verdreht, dass es in fragwürdige Missionstheorien paßt.
Aber wie unterscheidet man im Realfall zwischen einem interessierten Nichtjuden und demjenigen, der nur aus idiotischen Missionsmotiven beim Shiur auftaucht ?
Somit herrscht auf jüdischer Seite immer ein gewisses Mißtrauen, was sich bei Orthodoxen geradezu zur Phobie entwickelte. Und von daher ist es nur allzu logisch, dass selbst ich ein jüdisches Publikum vorziehe. Nicht aus dem Grunde, um alle andern auszuschließen, sondern weil ich bei einem jüdischen Publikum weiß, was ich habe. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch bei solch einem Publikum oft weniger tolle verständnisreiche Fragen kommen, doch ist es einfacher, damit zu leben.
In meiner vorherigen Umfrage ging es um das Thema: "Sollen Vorträge zum Judentum nur vor jüdischem Publikum gehalten werden ?"
Zwei Antworten machten bei den Abstimmenden das Rennen:
1. Das Publikum sei egal, Hauptsache man lerne etwas.
2. Es ist relevanter, zuerst Juden das Judentum zu vermitteln.
Ich selbst halte es mit der letzten Antwort. Leider ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Juden auf aller Welt nur geringe Kenntnisse über ihre eigene Religion hat. Die Gründe sind, wie so häufig, unterschiedlich. Nur von mangelndem Interesse zu reden ist falsch. Vielmals liegt Interesse vor, nur fehlt es vor allem in Deutschland an qualifizierten Einrichtungen, in denen jemand ernsthaft über das Judentum unterrichtet wird.
Mit die einzige qualifizierte Einrichtung ist CHABAD, die Lubawitscher Chassidim, und wie ich Chabad kenne, werden dort NUR halachische Juden unterrichtet. Kein Wunder, denn das Chabad – Pensum ist keine leichte Kost und erfordert viel Einsatz. Wer wirklich interessiert ist, dem kann ich die Chabad – Shiurim nur weiterempfehlen. Wer da meint, die reden dann eh nur vom Meschiach oder Ähnlichem, der liegt falsch, denn Chabad lehrt alle Themen im Judentum. Von der Halacha über den Talmud bis hin zur Chassidut.
Was immer wieder von deutschen jüdischen Lesern bemängelt wird, ist der fehlende jüdische Bekanntenkreis. Natürlich kann jeder auch nichtjüdische Freunde haben, doch dies räumt das Gefühl nicht aus, dass immer etwas fehlt. Man will auch einmal unter sich sein und über ganz bestimmte Themen reden. Das ist nur allzu verständlich.
Eine Patenlösung für den fehlenden jüdischen Freundeskreis in Deutschland gibt es nicht. Entweder sucht man sich etwas Virtuelles im Internet, zieht dorthin, wo man auf einen derartigen Bekanntenkreis trifft (Berlin oder Frankfurt) oder man geht ins Ausland. Letzteres geschieht in letzter Zeit sehr häufig und nicht wenige junge deutsche Juden ziehen nach London oder New York. Insbesondere jene, die ein relig. Leben führen wollen.
Vielleicht sollte sich in Deutschland an sich einmal gefragt werden, warum in dessen Nachbarländern wie der Schweiz (Basel und Zürich), Belgien (Antwerpen) oder Österreich sehr wohl ein jüdisch – religiöses Leben stattfinden kann. Wie kommt es, dass sich sogar viele Chassidim in Wien niederlassen ? Wieso wird ausgerechnet dort eine dementsprechende Infrastruktur aufgebaut ?
Meine deutsche Erfahrung war, dass sich die orthod. Gemeinden immer selbst blockieren. Die dortigen Gemeinderabbiner wollen einfach niemanden neben sich wirken haben, denn sonst könnten die Schäfchen woanders hin überlaufen und der Gemeinderabbi steht allein da. Aber wie man so schön sagt: "Konkurrenz belebt das Geschäft" und zumindest Chabad kam gerade recht, um deutschen Juden einmal ein wenig Wissen zu vermitteln, was sie woanders kaum oder nur begrenzt bekommen.
Aber zurück zur vorherigen Umfrage.
Ich finde es äußerst wichtig, dass zuerst Juden unterrichtet werden. Wozu sollte sich jemand hinstellen und vor einem gemischten Publikum über die Kaschrut oder den Schabbat sprechen, wenn die Nichtjuden im Publikum dieses Thema gar nichts angeht ? Allgemeinere Themen dagegen können vor einem gemischten Publikum stattfinden, doch halte ich es immer so, dass ich Abstriche mache. Heißt, gewisse Dinge erwähne ich nur vor einem rein jüdischen Publikum. Genauso halt es übrigens mein Rabbi, Rabbi Mordechai Machlis.
Aber das wiederum geht im Endeffekt auf Kosten der jüdischen Zuhörer, denn sollten sie bei einem Vortrag vor Juden und Nichtjuden dabei sein, erfahren sie nur die Hälfte.
Bisher habe ich nur begrenzte Vortragserfahrung und wenn, dann ausschließlich vor amerikanischen Juden. Ein Freund von mir, David Salomon, gab mir seine Vortragserfahrungen weiter.
Er unterrichte ausschließlich nur Juden und seine Gründen waren die gleichen wie die meinen. Es sei wichtig, dass vorzugsweise die Juden selbst etwas über ihre eigene Religion und Identität lernen.
Als ich in der vergangenen Woche bei einem Shiur (Vortrag) war, sprach mich der Referent, Rabbi Chaim Eisen, an. In der Woche zuvor hatte ich mit ihm eine Diskussion über den Rambam, die wir gleich zu Beginn des Shiurs vor dem Publikum fortsetzten.
Hierbei ging es auch darum, dass der Rambam (Maimonides) sowie viele andere Thorakommentatoren (z.B. Rashi) es komplett ablehnen, wenn ein Nichtjude die Thora lernt. Zwar heisst in es in mindestens zwei Talmud – Traktaten (u.a. in Talmud Avodah Zarah 3a), dass ein Nichtjude, der sich mit der Thora beschäftigt, genauso anzusehen ist, wie ein Hohepriester (Cohen HaGadol). Doch der Rambam, Rashi, und andere kommentieren, dass dieser Passuk meint, ein Nichtjude solle sich ausschließlich mit denjenigen Thoralehren, welche sich mit den "Sieben Gesetzen der Noachiden" auseinandersetzen.
Rabbi Eisen merkte an, dass zu diesen Meinungen ein Disput entstand und andere wiederum die Ansicht vertreten, dass ein Nichtjude dann die Thora bzw. weitere jüdische Themen lernen darf, wenn er wirkliches Interesse zeigt und das Gelernte nicht falsch wiedergibt oder für christliche Missionszwecke ausnutzen will. Sprich, Gelerntes so verdreht, dass es in fragwürdige Missionstheorien paßt.
Aber wie unterscheidet man im Realfall zwischen einem interessierten Nichtjuden und demjenigen, der nur aus idiotischen Missionsmotiven beim Shiur auftaucht ?
Somit herrscht auf jüdischer Seite immer ein gewisses Mißtrauen, was sich bei Orthodoxen geradezu zur Phobie entwickelte. Und von daher ist es nur allzu logisch, dass selbst ich ein jüdisches Publikum vorziehe. Nicht aus dem Grunde, um alle andern auszuschließen, sondern weil ich bei einem jüdischen Publikum weiß, was ich habe. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch bei solch einem Publikum oft weniger tolle verständnisreiche Fragen kommen, doch ist es einfacher, damit zu leben.
Abonnieren
Posts (Atom)












![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](valid-atom.png)